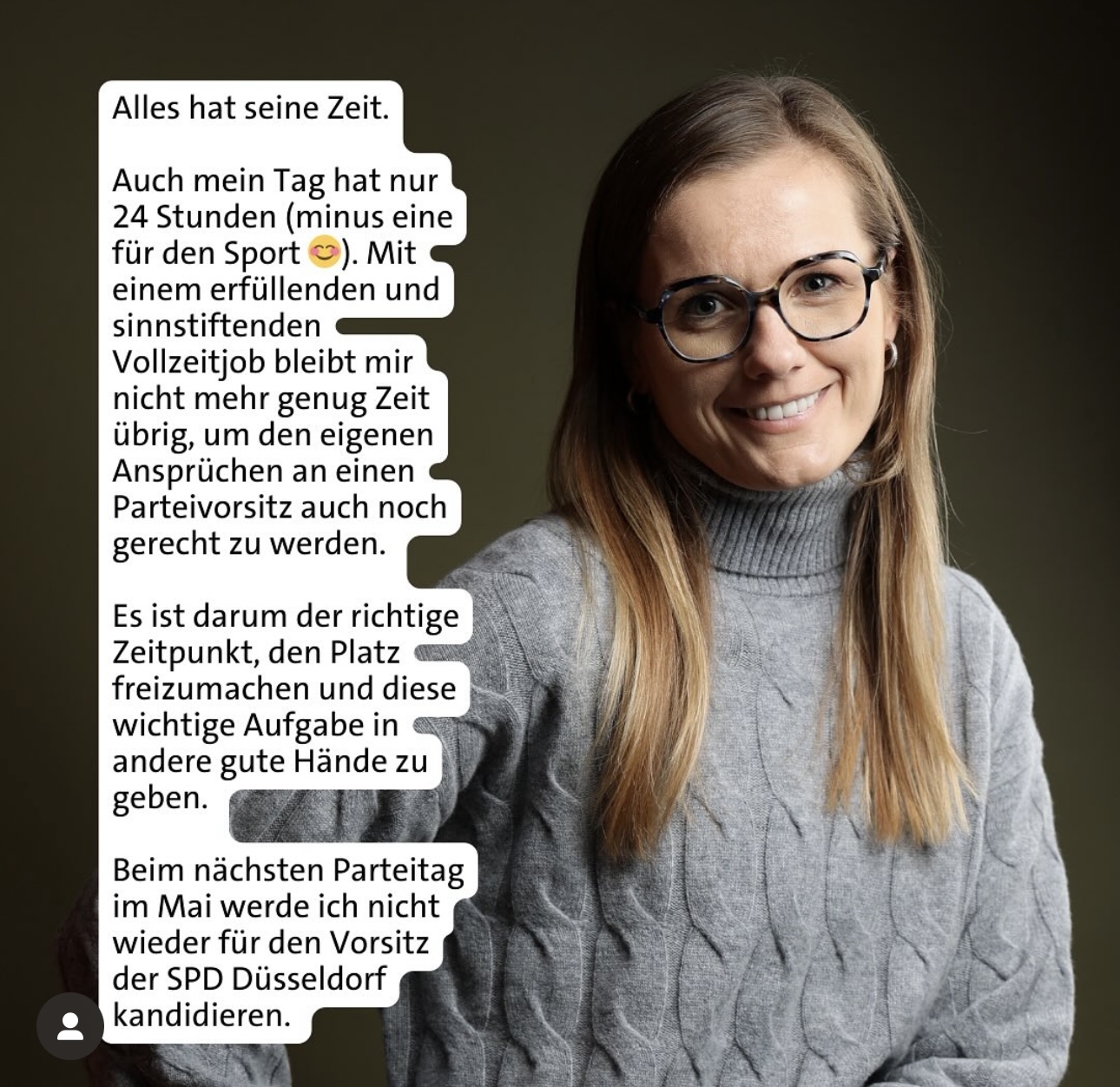Vodafone-Studie: Deutsche sehnen sich nach einer besseren Phone-Life-Balance

Foto: VODAFONE
(cs) Ständig erreichbar sein, scrollen, liken, teilen – das Smartphone ist längst unser täglicher Begleiter. Es vernetzt uns, informiert uns und erleichtert die Kommunikation. Doch der digitale Dauerkonsum hat auch Schattenseiten. Eine aktuelle Studie des Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmen Vodafone zeigt: Die Hälfte der Befragten verbringt täglich mehr als fünf Stunden online – mit spürbaren Auswirkungen auf das Wohlbefinden.
Digitale Balance im Alltag
„Deutschland steckt im digitalen Balanceakt. Smartphones sind unverzichtbar – sie bringen uns zusammen, erleichtern unseren Alltag und bereichern unser Leben. Doch wenn sie mehr belasten als nutzen, ist Umdenken gefragt. Als Vodafone übernehmen wir Verantwortung und möchten dabei helfen, die richtige Balance zwischen Online- und Offline-Welt zu finden. Wer nur auf Klicks und Likes achtet, verliert schnell den Blick für die realen Momente. Denn das beste soziale Netzwerk ist das echte Leben“, so Vodafone-CEO Marcel de Groot.
Versteckte Bildschirmzeit: Viele sind länger online als gedacht
Besonders auffällig: Die meisten unterschätzen ihre tägliche Bildschirmzeit. Mehr als ein Drittel der Befragten ist täglich zwischen fünf und acht Stunden online – manche sogar noch länger. Besonders jüngere Generationen erkennen oft erst im Nachhinein, wie hoch ihre tatsächliche Nutzungsdauer ist. Der ständige Konsum von Kurzvideos, Social Media oder Nachrichten führt schnell zu einer unbewussten, exzessiven Nutzung. Diese „Nebenbei-Nutzung“ beeinträchtigt nicht nur das Zeitmanagement, sondern kann auch gesundheitliche und soziale Folgen haben – von Kopfschmerzen bis hin zu einem gesteigerten Gefühl der Einsamkeit.
Social Media und News: Oft mehr Belastung als Bereicherung
Über alle Generationen hinweg gehören Instagram und Nachrichtenportale zu den meistgenutzten Plattformen. Doch der Haken: Social Media und Dauer-News hinterlassen häufig eine negative Stimmung. YouTube hingegen wird als inspirierend und motivierend empfunden. Besonders Jüngere glauben, ihre Smartphone-Nutzung sei sinnvoll, doch je mehr Zeit sie online verbringen, desto stärker nehmen sie die negativen Effekte wahr. Während der größte Nutzen in schneller Informationsbeschaffung und sozialer Vernetzung liegt, konsumiert fast die Hälfte Inhalte ohne echten Mehrwert. Zeitverschwendung und die Verbreitung von Fake News bleiben große Herausforderungen.
Generation Z besonders betroffen
„Always on“ – für die Generation Z ist ständige Erreichbarkeit nahezu selbstverständlich, bringt aber auch Stress. Besonders der Vergleich auf Social Media und die Angst, etwas zu verpassen („Fear of Missing Out“, FOMO) belasten die junge Generation. Sie erleben sowohl die positiven als auch die negativen Seiten der digitalen Welt besonders intensiv. Das hohe Suchtpotenzial birgt für sie ein größeres Risiko als für ältere Generationen. Boomer hingegen finden leichter eine gesunde Balance.
Die Vodafone-Studie zeigt: Die Sehnsucht nach einer besseren Phone-Life-Balance wächst. Bewusster Umgang mit digitalen Medien, digitale Detox-Phasen und mehr echte soziale Interaktion können helfen, wieder mehr Kontrolle über die eigene Bildschirmzeit zu gewinnen – für ein gesünderes, ausgeglicheneres Leben.