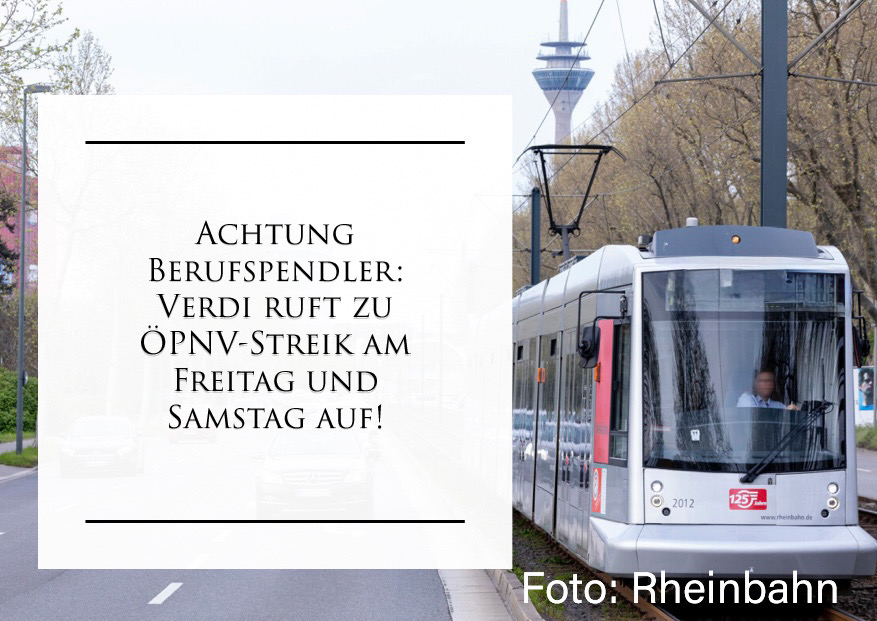(cs) Auf dem Gelände des ehemaligen Großmarktes an der Ulmenstraße 297 in Düsseldorf-Derendorf nimmt eines der spannendsten Handelsprojekte der kommenden Jahre Gestalt an: Mit der Grundsteinlegung startet der Bau des neuen Marktes von METRO Deutschland. Die Eröffnung ist für Mitte 2027 geplant.
Mit rund 7.500 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der neue Standort etwas kleiner ausfallen als der bisherige Markt in Grafenberg – dafür aber moderner, effizienter und näher an vielen gastronomischen Betrieben in der Innenstadt und im Norden der Stadt gelegen. Gesehen bei der Grundsteinlegung wurden unter anderem Annette Klinke, Bezirksbürgermeisterin Stadtbezirk 1 Düsseldorf, Florian Röhrs, Geschäftsführer BREMER West GmbH & Co. KG, Roland Ruffing, CEO METRO Deutschland, und Sabrina Ley, Geschäftsführerin Sales & Operations METRO Deutschland, an der Grundsteinlegung teil.
„Mit diesem Neubau setzen wir ein klares Signal: Wir investieren nicht nur in einen neuen Standort, sondern auch in die Zukunft der regionalen Gastronomie und in die Stadtteilentwicklung der Stadt Düsseldorf. Für unsere Gastronomiekundschaft, Hoteliers sowie Händlerinnen und Händler bedeutet der neue Markt eine noch bessere, moderne und bedarfsgerechte Einkaufsumgebung. Der Grundstein, den wir heute legen, steht für einen Großhandel, der nachhaltiger und leistungsfähiger ist und den wir hier an der Ulmenstraße Schritt für Schritt Realität werden lassen“, so Roland Ruffing.
Großmarkt schließt – Fläche wird neu genutzt
Möglich wird das Projekt, weil der traditionsreiche Düsseldorfer Großmarkt an der Ulmenstraße am 31. Dezember 2024 geschlossen wurde, um Platz für die neue METRO und eine geplante Weiterentwicklung des Areals zu schaffen. Das Areal wird damit neu geordnet – ein bedeutender Einschnitt für den Standort, der jahrzehntelang ein zentraler Umschlagplatz für Obst, Gemüse und weitere Frischeprodukte war.
Der neue METRO-Markt soll die Versorgung von Gastronomie, Hotellerie und Gewerbekunden in Düsseldorf und der Region langfristig sichern. Wer künftig bei METRO einkauft, wird dies voraussichtlich vor allem in Derendorf tun.
Zentrale bleibt in Flingern
Wichtig für den Standort Düsseldorf: Die METRO-Unternehmenszentrale bleibt weiterhin in Flingern. Dort ist zusätzlich ein kleinerer Gastro-Markt vorgesehen. Gleichzeitig werden durch den Umzug größere Flächen frei, auf denen unter anderem ein neues Wohngebiet entstehen soll – ein weiterer Baustein in der städtebaulichen Entwicklung des Quartiers.
Impuls für Derendorf
Mit dem Neubau an der Ulmenstraße erhält Derendorf einen modernen Großhandelsstandort, der verkehrlich gut angebunden ist und die wachsende Gastronomieszene der Stadt bedienen soll.
Nach Jahren der Diskussionen und Planungen geht es nun sichtbar voran: Mit dem besseren Wetter starten die Bauarbeiten für das Projekt, das nicht nur für METRO-Kunden, sondern auch für die Stadtentwicklung in Düsseldorf von Bedeutung ist.
Die Stadt verfolgt für die gesamten Flächen des ehemaligen Großmarktes andere strategische Stadtentwicklungsziele, unter anderem Umsiedlung von Gewerbeflächen zur zukünftigen Wohnbauflächenentwicklung. Durch die Umsiedlung des Metro Cash&Carry Marktes hin zur Ulmenstraße in Derendorf können an dessen bisherigen Standort in Flingern bis zu 1.400 Wohnungen entstehen.
Die übrigen im städtischen Besitz verbleibenden Flächen sollen langfristig gewerblich verpachtet werden. Ziel ist, damit den Produktionsstandort Düsseldorf nachhaltig zu stärken. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, befindet sich derzeit ein neuer Bebauungsplan in Aufstellung.