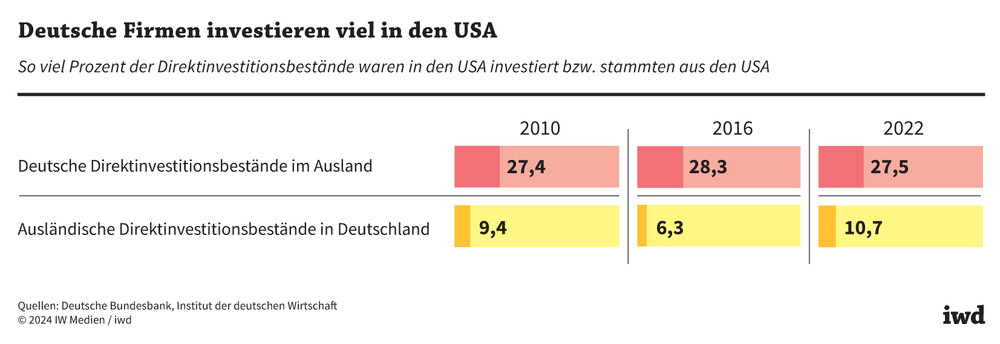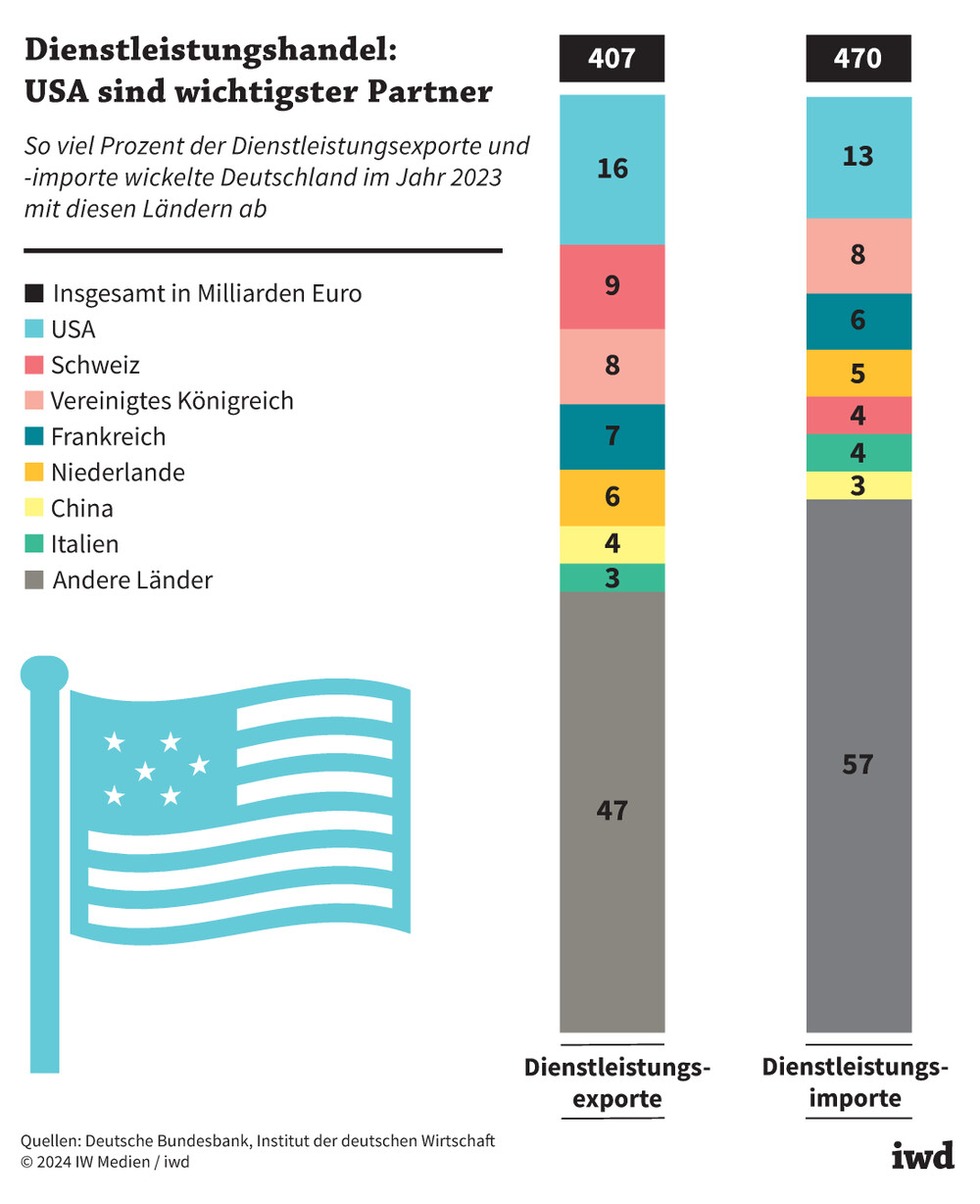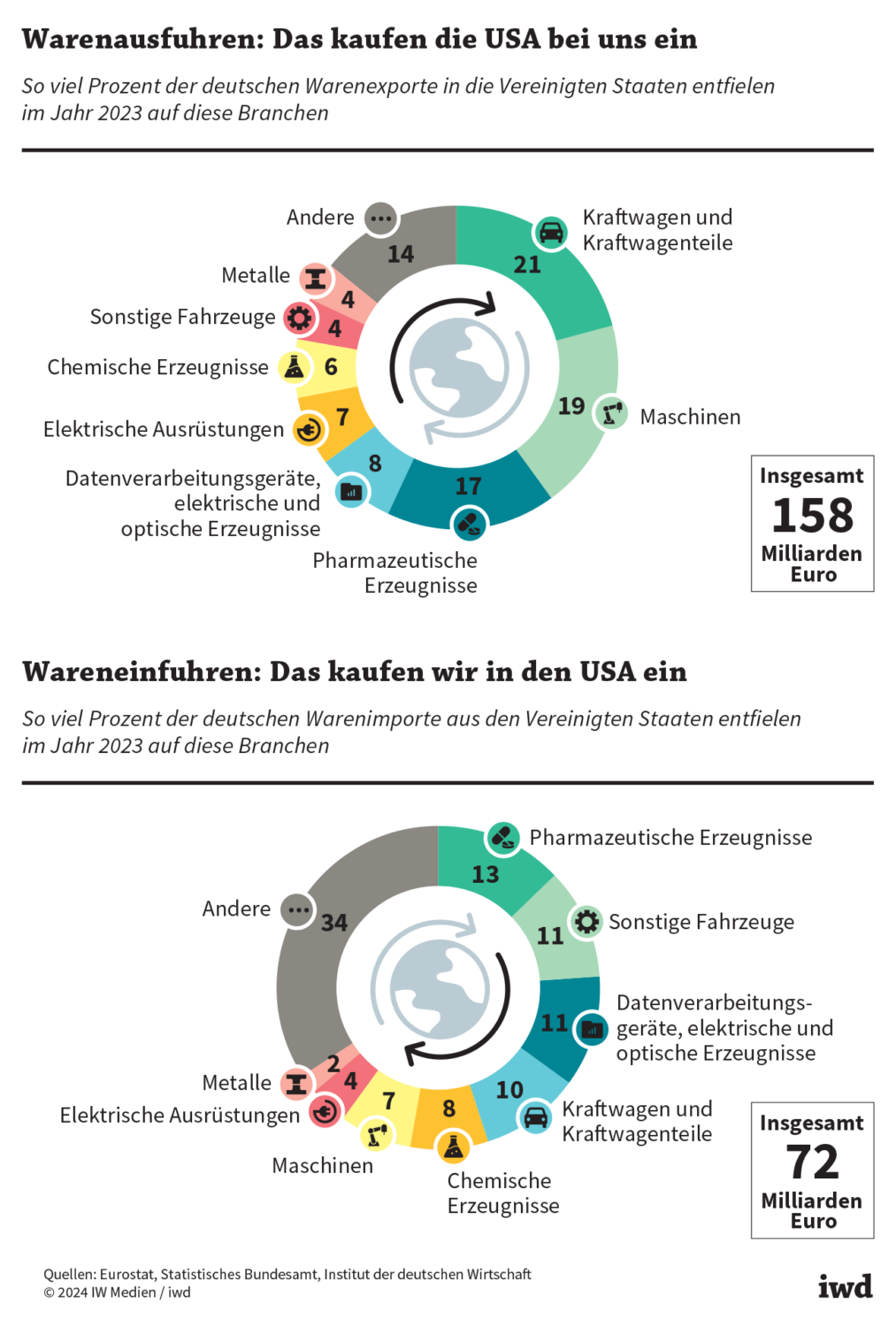Rheinmetall präsentiert Rekordzahlen: Umsatz steigt um mehr als ein Drittel

Rheinmetall-Chef Armin Papperger Foto: Frank Wiedemeier
Die Düsseldorfer Rheinmetall AG schließt das dritte Quartal 2024 mit erneuten Rekordwerten sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag ab. Mit der weiterhin hohen Nachfrage durch die Bundeswehr und die Streitkräfte in den Partnerstaaten der EU und der NATO sowie durch die anhaltende Hilfe für die Ukraine zeigt sich die Marktsituation im militärischen Geschäft weiterhin dynamisch. Der zivile Bereich des Konzerns hingegen blieb leicht hinter dem Vorjahr zurück.
Beim operativen Free Cashflow gelang dem Konzern durch deutlich gestiegene Kundenanzahlungen eine signifikante Verbesserung.
Rheinmetall bestätigt nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 aufgrund der erwarteten Geschäftsentwicklung im vierten Quartal die Umsatz- und Ergebnis-prognose für das Gesamtjahr 2024. Bei der operativen Renditemarge geht der Konzern nun von einem Wert am oberen Ende der bestehenden Guidance aus.
Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, zur Unternehmens-entwicklung: „Rheinmetall wird gebraucht, das zeigen unsere zahlreichen Auftragserfolge. Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten. In vielen Ländern sind wir zukunftsweisende Kooperationen eingegangen und haben aussichtsreiche Projekte – so in den USA, in Großbritannien, Italien oder der Ukraine. Wir haben Großaufträge in unserer Pipeline, die uns in den kommenden Jahren weiter steigende Umsätze sichern. Zusätzlich bauen wir neue Werke, weiten unsere Kapazitäten massiv aus und tätigen strategische Akquisitionen. So kommen wir unserem Ziel näher, ein globaler Rüstungschampion zu werden.“
Rheinmetall-Konzern: Profitables Umsatzwachstum von 36% – Rheinmetall Nomination um die Hälfte gesteigert
Der Konzernumsatz kletterte nach neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum spürbar um 1.650 MioEUR oder 36% auf 6.268 MioEUR (Vorjahr: 4.618 MioEUR). Der Anteil des mit dem deutschen Kunden erzielten Umsatzes ist in den ersten drei Quartalen 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6%-Punkte auf 30% gestiegen, der Auslandsanteil beträgt 70%.
Das operative Ergebnis zum 30. September 2024 liegt mit 705 MioEUR um 295 MioEUR oder 72% über dem Vorjahreswert von 410 MioEUR. Die Verbesserung des operativen Ergebnisses wurde neben dem Umsatzwachstum unter anderem durch den Ergebnisbeitrag der im August 2023 in Spanien akquirierten Rheinmetall Expal Munitions vorangebracht. Die operative Ergebnismarge des Konzerns verbesserte sich mit Ablauf des dritten Quartals 2024 auf 11,3% (Vorjahr: 8,9%).