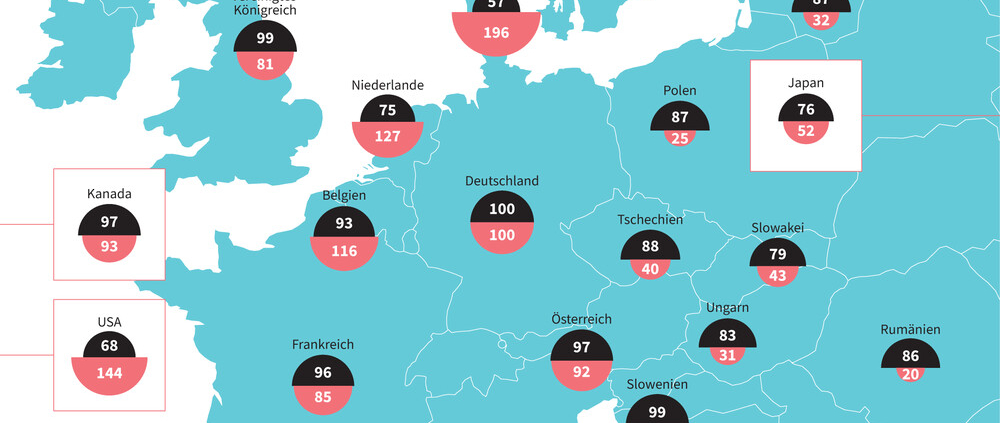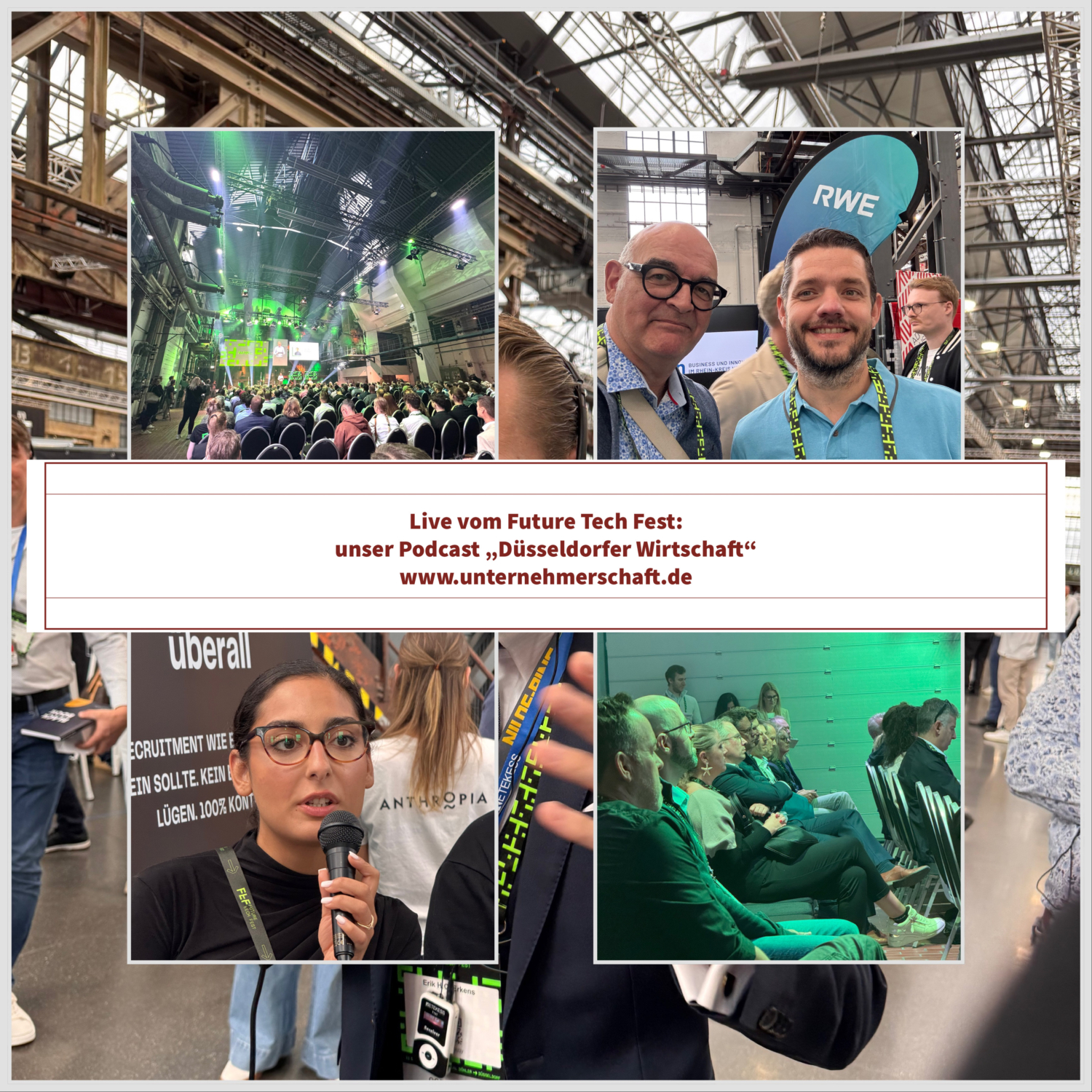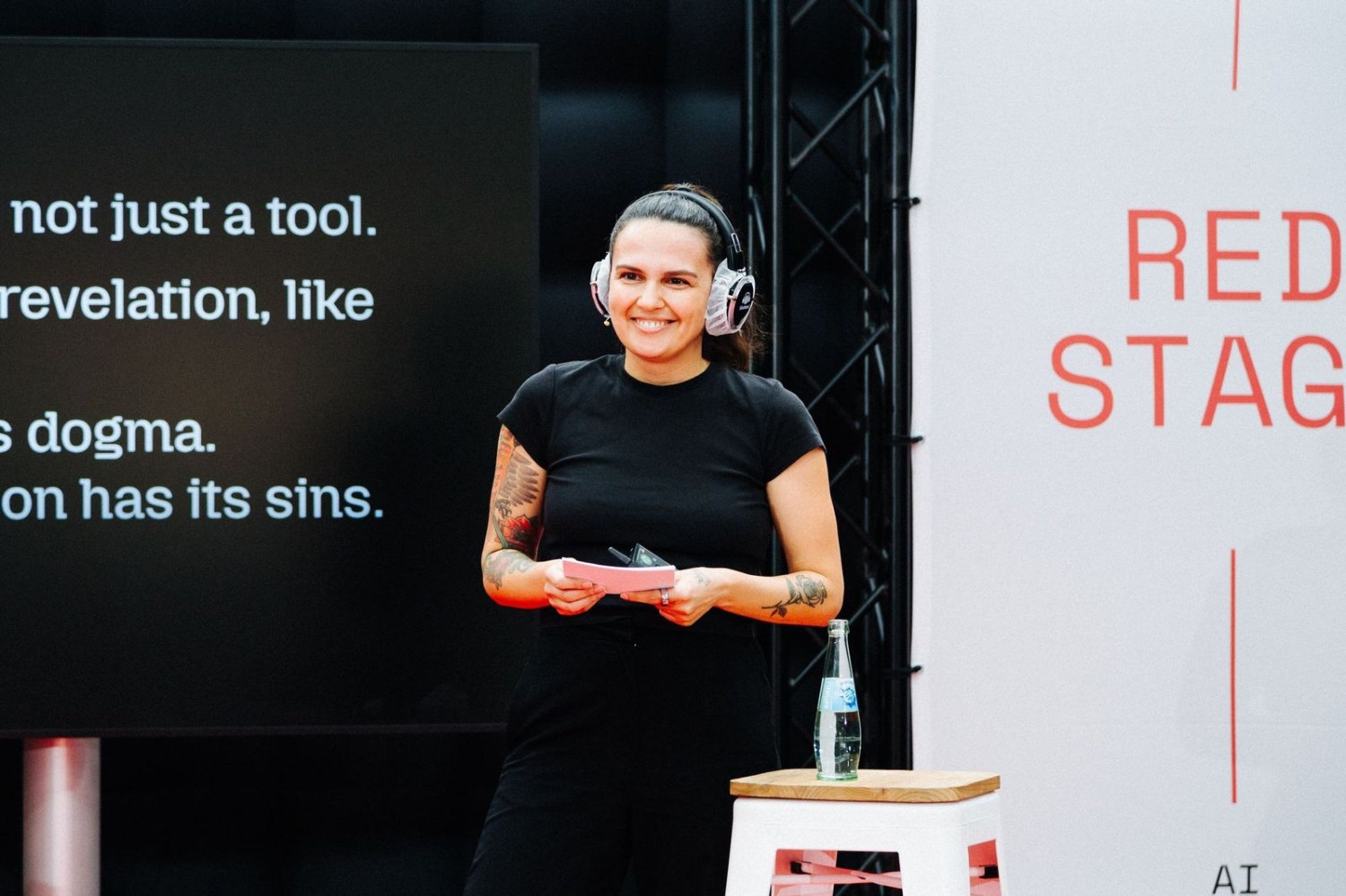(cs) Die METRO AG führt ihr soziales Engagement mit dem Projekt „Housing First meets Gastro“ auch in diesem Jahr erfolgreich weiter. In Kooperation mit dem Verein Housing First Düsseldorf e. V. bietet das Unternehmen ehemals obdachlosen Menschen eine echte Chance auf gesellschaftliche Teilhabe und einen nachhaltigen Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben – durch praxisnahe Trainings in der Gastronomie.
Vom festen Dach über dem Kopf zur festen Perspektive
Der Verein Housing First Düsseldorf e. V. ist Teil einer europaweiten Initiative, die sich für die Beendigung von Wohnungslosigkeit einsetzt – mit einem Konzept, das in seiner Klarheit überzeugt: Zuerst Wohnraum, dann soziale und berufliche Stabilisierung. Der Verein wird von der Stadt Düsseldorf gefördert und vermittelt obdachlose Menschen in langfristige Mietverhältnisse, begleitet durch flexible Hilfsangebote, die den Wohnungserhalt sichern sollen.
Doch mit dem Einzug in eine eigene Wohnung ist der Weg zurück in die Gesellschaft noch nicht abgeschlossen. Der nächste logische Schritt: die Integration in den Arbeitsmarkt. Hier setzt die gemeinsame Initiative mit METRO an – und das mit nachweisbarem Erfolg.
Gastronomie als Sprungbrett: Ausbildung, Struktur, Selbstvertrauen
„Housing First meets Gastro“ geht 2025 bereits in die zweite Runde. Das Konzept: Ehemals wohnungslose Menschen erhalten ein vierwöchiges Training in der Gastronomie, das sowohl in der professionellen Testküche von METRO als auch in der Kantine auf dem METRO Campus durchgeführt wird. Unter Anleitung erfahrener Küchenprofis lernen die Teilnehmenden alles Wichtige – von Hygienestandards über die Zubereitung einfacher Gerichte bis hin zur Teamarbeit in einer Großküche.
Für viele bedeutet dieses Training nicht nur eine erste berufliche Qualifikation, sondern auch einen neuen Tagesrhythmus, Struktur und – vielleicht am wichtigsten – ein gestärktes Selbstbewusstsein. Die Teilnehmer werden anschließend in gastronomische Betriebe vermittelt, wo sie eine zweimonatige Testphase absolvieren, um erste praktische Erfahrungen im realen Arbeitsumfeld zu sammeln.
Dennis Nikolay, Projektleiter bei Housing First Düsseldorf e. V., betont:
„Menschen brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch eine Perspektive. Die Kooperation mit METRO beweist, wie Wirtschaft und Sozialarbeit gemeinsam nachhaltige Lösungen schaffen können. Die Teilnehmenden erhalten eine Chance auf ein neues, geregeltes und unabhängiges Leben.“
Erfolg, der motiviert – für Teilnehmende und Partnerbetriebe
Schon der erste Durchlauf 2024 zeigte eindrucksvoll, wie viel Potenzial in dem Projekt steckt. Fünf der damaligen Teilnehmer fanden im Anschluss eine feste Anstellung – unter anderem im renommierten Düsseldorfer Restaurant Klapdohr Delikatessen sowie in der Betriebskantine von METRO.
Lars Klapdohr, Gastronom und Unterstützer der Initiative, berichtet begeistert von seinem neuen Teammitglied:
„Die Gastronomie ist eine tolle Branche – offen, bunt und oft sehr verständnisvoll gegenüber Menschen mit ungewöhnlichen Lebenswegen. Unser Kollege Heiko, der über das Projekt zu uns kam, ist ein echter Glücksgriff. Er bringt sich voll ein, ist engagiert und motiviert. Wir freuen uns, ihn auf seinem neuen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen.“
Auch Christopher Rogge, Leiter der METRO-Kantine, lobt die Teilnehmenden der zweiten Runde:
„In der Küche zählt Teamgeist – und genau den haben auch unsere neuen Kollegen mitgebracht. Ihre Motivation ist ansteckend, sie sind mit Spaß und Einsatz bei der Sache.“
Ein besonders eindrückliches Beispiel ist Ralf Hesselfeld, der seit dem ersten Durchgang fester Bestandteil des Küchenteams der METRO-Kantine ist. Nach Jahren auf der Straße hat er durch das Projekt nicht nur Arbeit, sondern auch Selbstvertrauen und neue Lebensfreude gefunden:
„Ich hätte nie gedacht, wieder Teil eines Teams zu sein. Bei METRO wurde ich nicht nur aufgenommen, sondern gebraucht. Das hat mein Leben verändert.“
Chancengleichheit als gelebte unternehmerische Verantwortung
Für METRO ist das Projekt weit mehr als ein Akt der Wohltätigkeit – es ist Ausdruck einer unternehmerischen Haltung, die auf Verantwortung, Inklusion und Chancengleichheit setzt.
Ivonne Bollow, Senior Vice President Corporate Communications, Public Policy & Responsibility bei METRO, unterstreicht:
„Wir glauben an die Kraft von Chancen und daran, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich neu zu entfalten – wenn er die richtige Unterstützung bekommt. Deshalb stellen wir gerne Ressourcen, Zeit und Fachwissen bereit. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Lösung eines weiteren gesellschaftlichen Problems: dem Fachkräftemangel in der Gastronomie.“




 Wann & Wo?
Wann & Wo? Wer steckt dahinter?
Wer steckt dahinter?