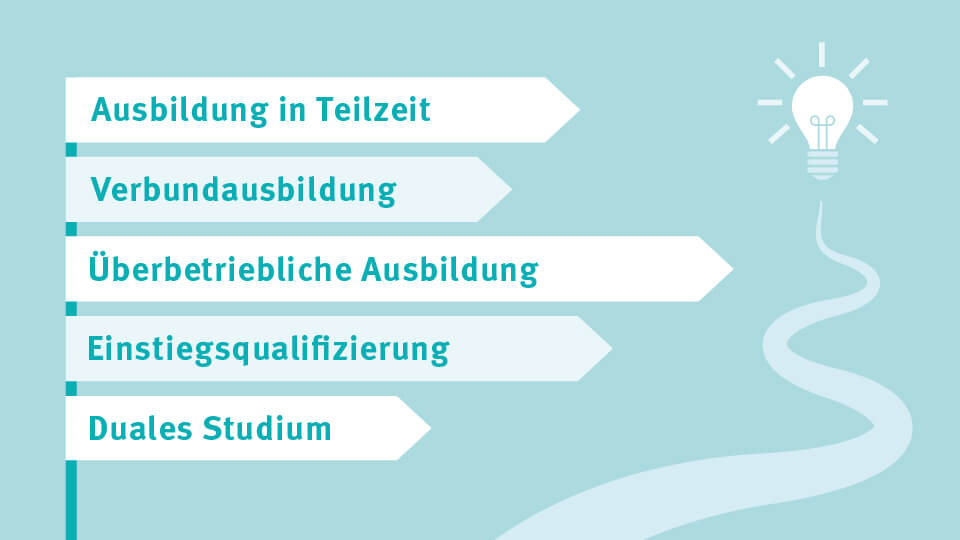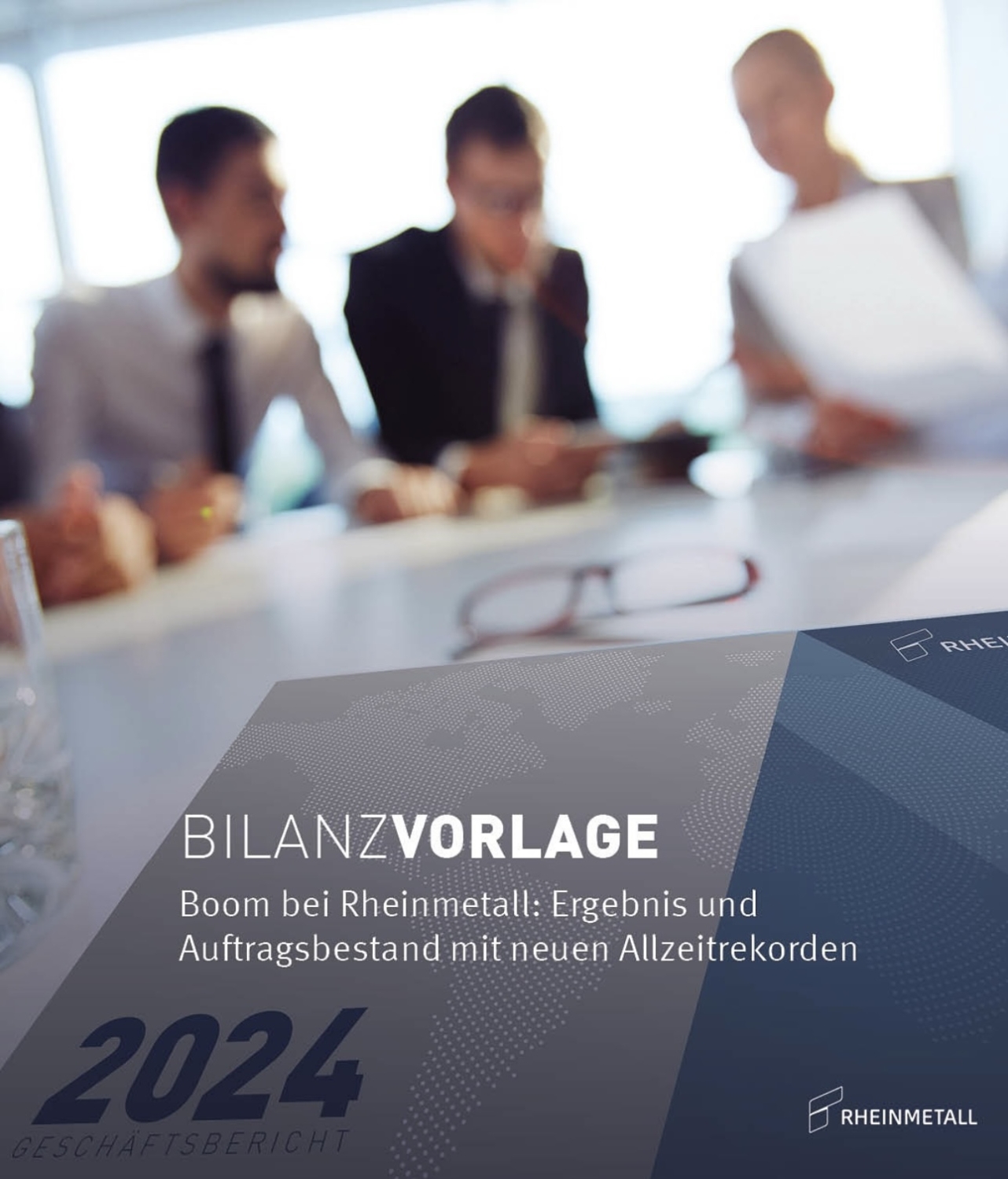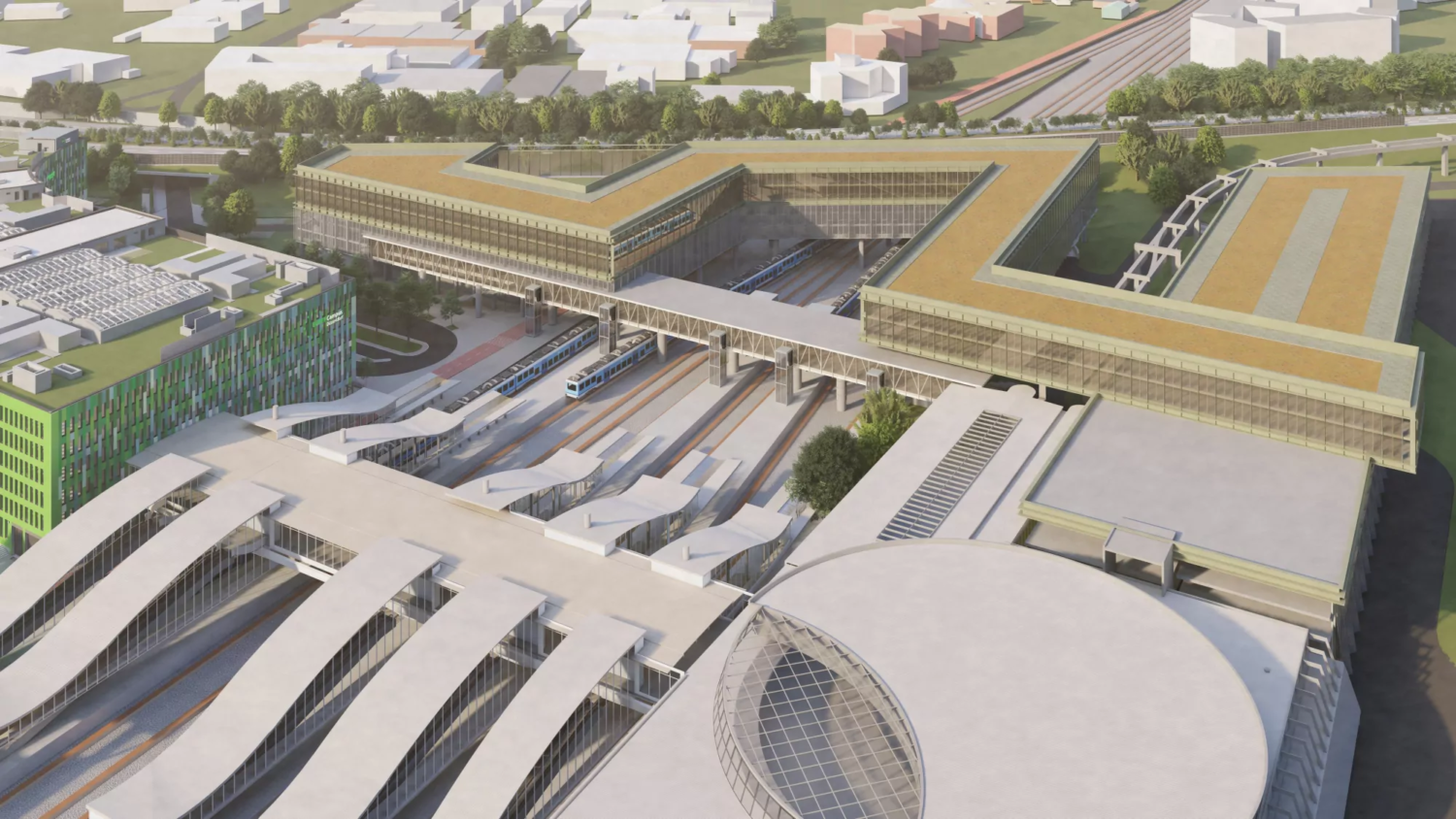(cs) Das Düsseldorfer Technologie-Unternehmen hat seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und das Geschäftsjahr 2024 erneut mit Rekordzahlen abgeschlossen. Beim operativen Konzernergebnis wurde ein neuer Höchstwert erzielt, während der Rheinmetall Backlog des Technologiekonzerns wie im Vorjahr einen neuen Rekord erreichte. Großaufträge von militärischen Kunden sichern die Auslastung der kommenden Jahre.
Starkes Wachstum im militärischen Geschäft
Der Konzernumsatz stieg insbesondere in den Divisionen des militärischen Geschäfts, das mittlerweile rund 80 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Im zivilen Bereich zeigte sich ein gemischtes Bild: Während im Bereich Trade der höchste Umsatz der Firmengeschichte erzielt wurde, verlief das Geschäft mit Automobilherstellern branchentypisch rückläufig.
Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Rheinmetall weiteres starkes Umsatz- und Ergebniswachstum. In der aktuellen sicherheitspolitischen Lage sieht sich das Unternehmen strategisch gut positioniert, um mit sicherheitstechnischen Produkten eine zentrale Rolle in Deutschland und den Partnerländern bei der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit einzunehmen.
Armin Papperger: „Zeitenwende 2.0“ erfordert massive Investitionen
Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, betont: „Rheinmetall stellt sich den Herausforderungen der Zeitenwende 2.0. Wir sind gut vorbereitet: Unsere Kapazitäten wurden bereits massiv erhöht und werden weiter ausgebaut. In den vergangenen zwei Jahren haben wir fast 8 Milliarden Euro investiert, um neue Werke zu errichten, Zukäufe zu tätigen und Lieferketten abzusichern. Wir tragen Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes und Europas. Mit einem Umsatzwachstum von 50 % im militärischen Geschäft entwickelt sich Rheinmetall vom europäischen Systemhaus zum globalen Champion.“
Weiterhin führt Papperger aus: „Eine Epoche der Aufrüstung in Europa hat begonnen, die uns allen viel abverlangen wird. Für Rheinmetall ergeben sich daraus jedoch außergewöhnliche Wachstumsperspektiven. In zentralen Bereichen der militärischen Ausstattung sind wir ein wichtiger Akteur. Dank unserer Kapitalstärke, unserer technologischen Expertise und unserer hochmotivierten Mitarbeitenden werden wir den Regierungen als verlässlicher und leistungsfähiger Partner zur Seite stehen.“
Erneuter Gewinnsprung bei steigenden Umsätzen
Der Rheinmetall-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 9,75 Milliarden Euro – ein Anstieg um 36 % gegenüber dem Vorjahr (7,18 Milliarden Euro). Damit erfüllte der Konzern seine Prognose für 2024, die auf rund 10 Milliarden Euro angesetzt war.
Das signifikante Wachstum resultierte vor allem aus den Divisionen der Sicherheits- und Verteidigungstechnik, die von der steigenden Nachfrage infolge der sicherheitspolitischen Zeitenwende profitierten. Die Division Power Systems, die zu Jahresbeginn 2024 aus der Zusammenlegung der Bereiche Sensors and Actuators sowie Materials and Trade entstand, blieb hingegen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen leicht hinter den Vorjahreszahlen zurück.
Der Anteil des nationalen Geschäfts am Konzernumsatz stieg durch das wachsende Geschäftsvolumen mit der Bundeswehr. Dadurch sank der Auslandsanteil am Gesamtumsatz auf 70 % (Vorjahr: 76 %).
Am 31. Dezember 2024 lag der Rheinmetall Backlog bei 55 Milliarden Euro und erreichte damit nach 38 Milliarden Euro im Vorjahr einen neuen Höchstwert. Diese Zahl umfasst den verbindlichen Auftragsbestand (Order Backlog), bestehende Rahmenverträge (Frame Backlog) sowie den Nominated Backlog des zivilen Geschäfts.
Operatives Konzernergebnis auf Rekordhoch
Das operative Konzernergebnis stieg um 61 % auf 1,48 Milliarden Euro und übertraf damit deutlich das Umsatzwachstum. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 918 Millionen Euro – damals bereits der höchste in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Die operative Marge im Konzern stieg auf 15,2 % (Vorjahr: 12,8 %), während sie im Defence-Geschäft sogar 19 % erreichte.
Das Ergebnis nach Steuern kletterte auf 808 Millionen Euro und übertraf damit den Vorjahreswert von 586 Millionen Euro um 38 %. Nach Abzug des auf andere Gesellschafter entfallenden Ergebnisses von 91 Millionen Euro (Vorjahr: 51 Millionen Euro) ergibt sich ein auf die Aktionäre der Rheinmetall AG entfallendes Ergebnis von 717 Millionen Euro (Vorjahr: 535 Millionen Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 16,51 Euro nach 12,32 Euro im Jahr zuvor.
Dividendenvorschlag mit deutlicher Erhöhung
Basierend auf diesen starken Geschäftszahlen wird der Hauptversammlung am 13. Mai 2025 vorgeschlagen, eine Dividende von 8,10 Euro je Aktie auszuzahlen (Vorjahr: 5,70 Euro). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 39,0 % (Vorjahr: 38,9 %), gemessen am Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten vor PPA-Effekten.
Mit diesen Zahlen bestätigt Rheinmetall seinen Wachstumskurs und setzt seine Transformation zu einem globalen Anbieter sicherheitstechnischer Lösungen fort.