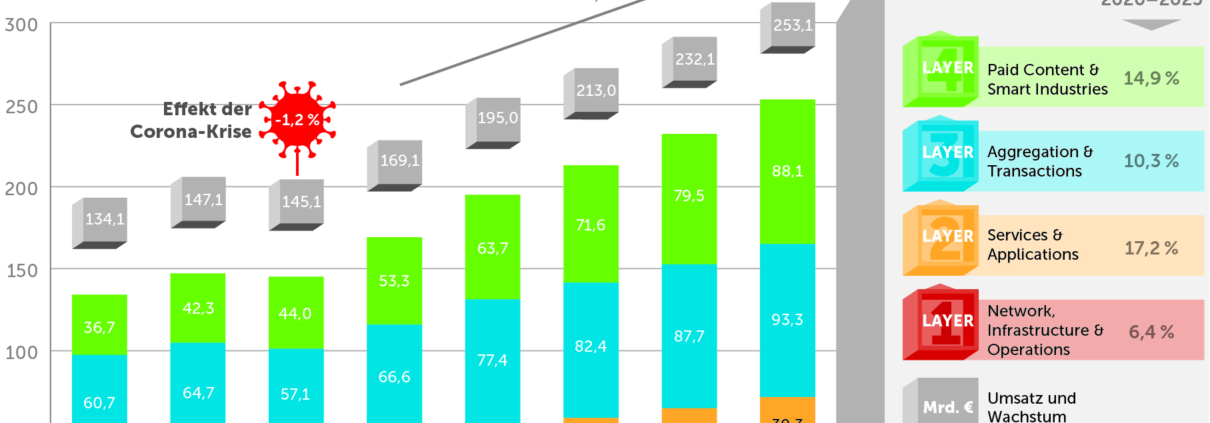Premiere im Doppelpack: Zwei neue Langstreckenflugzeuge am Flughafen Düsseldorf
(cs) Am Flughafen Düsseldorf hat ein neues Kapitel internationaler Luftverkehrsanbindung begonnen: Erstmals landete der hochmoderne Airbus A321LR von Etihad Airways in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt – und markiert damit den Start einer neuen täglichen Nonstop-Verbindung nach Abu Dhabi.
Die Einführung des A321LR auf dieser Strecke bedeutet für Reisende aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlandenein spürbares Plus an Flexibilität, Komfort und Anschlussmöglichkeiten. Anstelle der bisherigen drei wöchentlichen Verbindungen hebt Etihad Airways nun täglich in Richtung der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ab – mit optimalen Umsteigeverbindungen zu Zielen in Asien, Afrika und Australien, darunter Bangkok, Singapur, Delhi oder Johannesburg.
Düsseldorf als europäische Premiere für den A321LR
„Wir freuen uns, als erster europäischer Flughafen den neuen Airbus A321LR von Etihad zu begrüßen“, sagt Dr. Henning Pfisterer, Senior Vice President Aviation am Flughafen Düsseldorf. „Damit schlagen wir ein neues Kapitel in unserer starken Partnerschaft mit der Airline auf. Für Reisende aus unserer Region bedeutet die tägliche Verbindung nach Abu Dhabi mehr Möglichkeiten bei der Reiseplanung und hervorragende Anschlussoptionen. Das stärkt unsere internationale Anbindung und macht Düsseldorf für Geschäfts- und Urlaubsreisende noch attraktiver.“
Auch Etihad Airways unterstreicht die Bedeutung dieser Premiere. Javier Alija, Vice President Global Sales, betont: „Der Einsatz des A321LR markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Entwicklung. Er verbindet Effizienz mit Premiumkomfort und macht es möglich, ab Düsseldorf täglich nach Abu Dhabi zu fliegen. Dass die NRW-Landeshauptstadt der erste europäische Standort ist, an dem wir den A321LR einsetzen, unterstreicht die Bedeutung Düsseldorfs in unserem Streckennetz.“
Komfort auf Langstreckenniveau
Der Airbus A321LR spielt eine zentrale Rolle in Etihads Wachstumsstrategie „Journey 2030“. Die Airline hat insgesamt 30 Flugzeuge dieses Typs bestellt, von denen allein zehn weitere bis Ende 2025 ausgeliefert werden sollen. Die Maschine verbindet wirtschaftliche Effizienz mit einem völlig neuen Maß an Komfort – und das auf einer Schmalrumpf-Langstrecke.
Und dann gab es noch eine Premiere
Am Abend kam erstmals bei einem Linienflug von Madrid nach Düsseldorf der Airbus A321XLR von Iberia zum Einsatz.
Während der LR die bestehende Verbindung in die Golfmetropole stärkt, steht der XLR für die nächste Entwicklungsstufe im internationalen Luftverkehr. Eine Reihe von Airlines setzt große Erwartungen in den neuen Flugzeugtyp. Er verbindet eine Reichweite von bis zu 8.700 Kilometern mit deutlich geringeren Betriebskosten pro Flug im Vergleich zu herkömmlichen großräumigen Langstreckenjets. Durch die geringere Sitzplatzkapazität sinkt für Fluggesellschaften das wirtschaftliche Risiko bei der Aufnahme neuer Strecken und die Abhängigkeit von Zubringerflügen, um hohe Auslastungen zu erzielen.
Der Einsatz auf kürzeren Routen, wie gestern zwischen Madrid und Düsseldorf, ist in der Luftfahrtbranche ein übliches Verfahren, um die Betriebsabläufe zu testen und das Personal mit dem neuen Fluggerät vertraut zu machen, bevor es auf seinen eigentlichen Langstreckeneinsätzen zum Zuge kommt.
Für den größten Airport Nordrhein-Westfalens eröffnet der A321XLR realistische Perspektiven für Nonstop-Verbindungen nach Nordamerika oder Asien. Das Flugzeug könnte in den kommenden Jahren die Weiterentwicklung des Düsseldorfer Langstreckennetzes entscheidend prägen.

Erstmalig in Düsseldorf: Airbus A321XLR von Iberia nach der Landung aus Madrid. Foto: Flughafen Düsseldorf