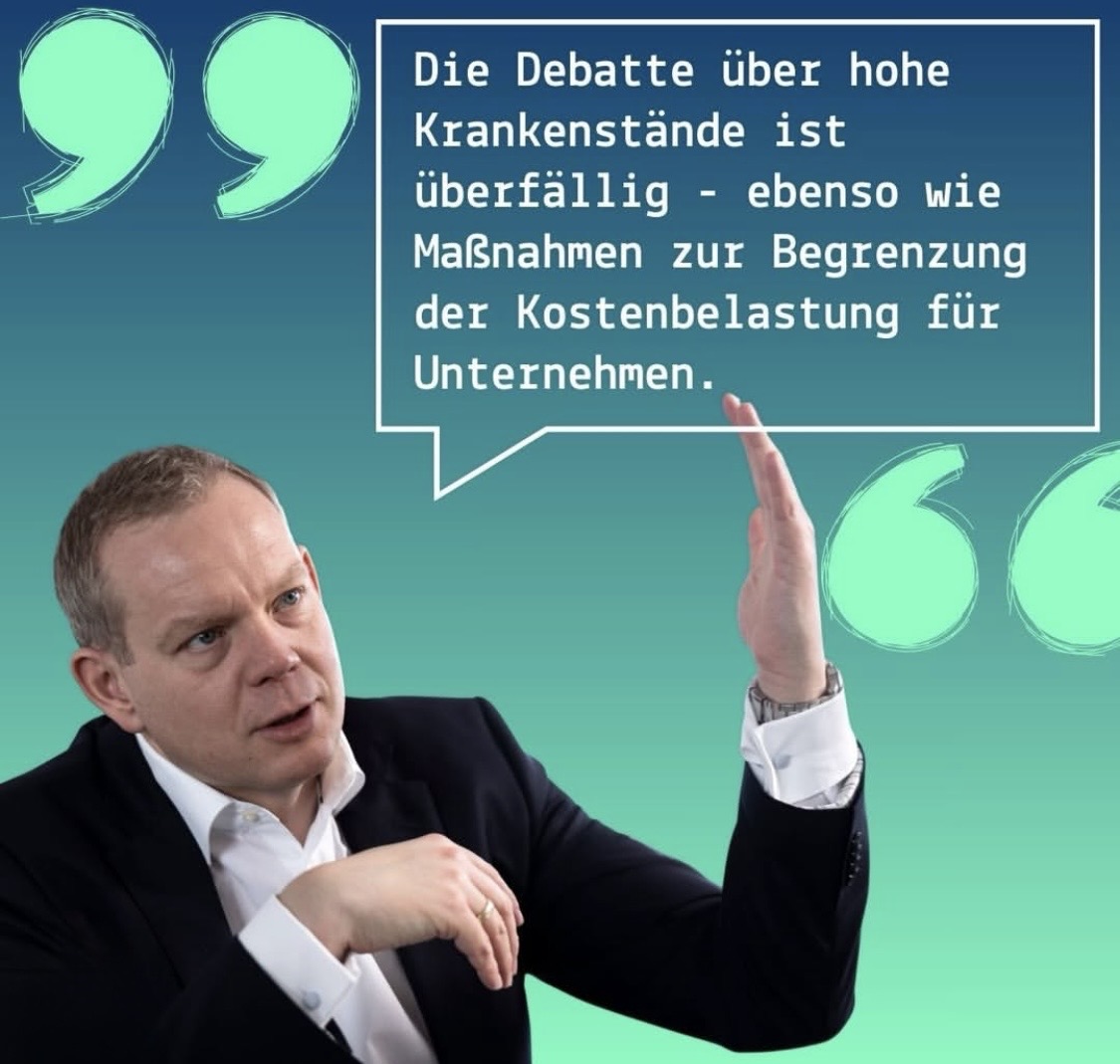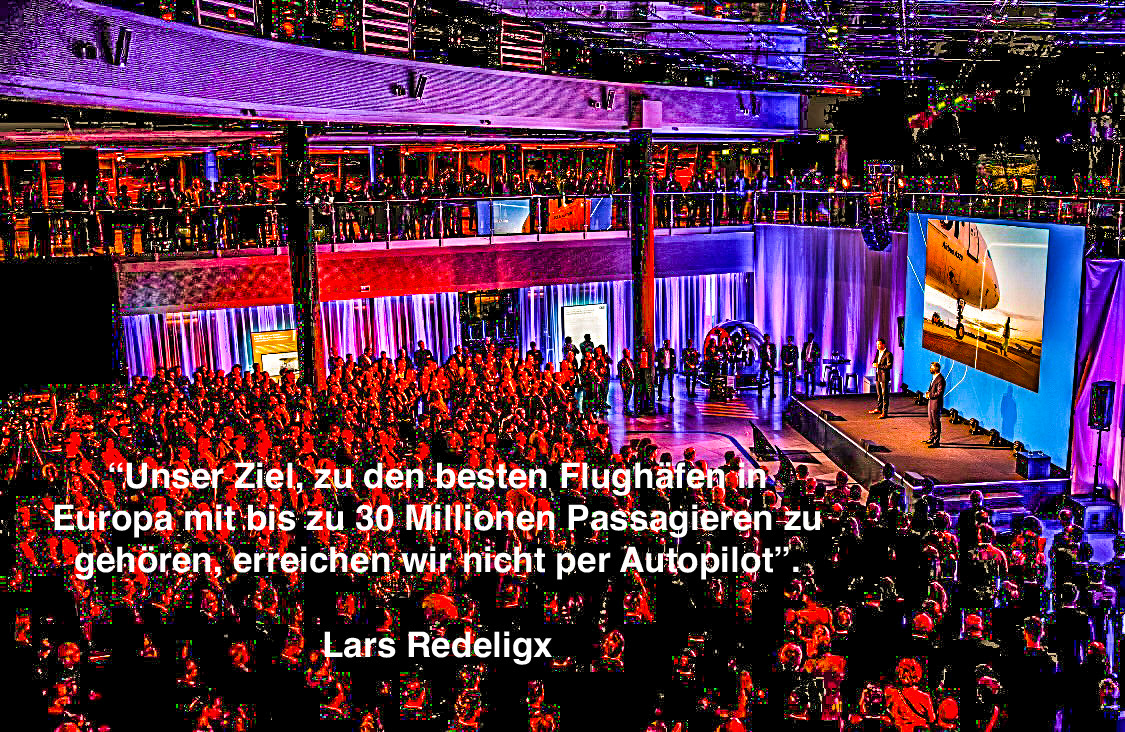(cs) Mehr als 900 Gäste erlebten einen Abend zwischen Standortbestimmung und Zukunftsvision: der Flughafen lud zum Neujahrsempfang. Und da wurde Tacheles gesprochen. Wir fassen den Abend zusammen.
Die Gastgeber, das Geschäftsführungsduo Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt, präsentierten die aktuellen Zahlen des Flughafens: Mehr als 21 Millionen Passagiere begrüßte der Düsseldorfer Airport im vergangenen Jahr – eine neue Bestmarke seit Corona. Der Sommerflugplan 2025 hat mit neuen Airlines, zusätzlichen Zielen und einem erweiterten Streckennetz die internationale Anbindung Düsseldorfs weiter gestärkt. Doch der Betrieb bleibt anspruchsvoll, wie die Herbstferien zeigten.
Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller betonte die Bedeutung des Flughafens für die Landeshauptstadt und die Region. Der Flughafen sei weit mehr als Infrastruktur, sondern ein zentraler Standortfaktor und Tor zur Welt. Seine Leistungsfähigkeit entscheide mit darüber, wie international, attraktiv und wettbewerbsfähig Düsseldorf sei. Verlässlichkeit schaffe Vertrauen, und dieses sei im Bereich Mobilität ein entscheidender Faktor.
Qualitätsoffensive und Appell an die Politik
“Unser Ziel, zu den besten Flughäfen in Europa mit bis zu 30 Millionen Passagieren zu gehören, erreichen wir nicht per Autopilot”, machten Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt deutlich. Das umfassende Qualitätsprogramm “Off-Block” habe seit 2023 in jedem Jahr mess- und spürbare Fortschritte bei Abfertigung und Passagiererlebnis gebracht. Die Geschäftsführer kündigten weitere Verbesserungen bei den Sicherheitskontrollen und der Gepäckanlage an.
Verbunden damit war ein klarer Appell an die Bundespolitik: Der Düsseldorfer Airport will mehr moderne CT-Technik einsetzen, um die Kontrollen effektiver zu gestalten. “Deshalb begrüßen und unterstützen wir die Initiative der Bundespolizei, kurzfristig weitere CT-Geräte am Standort zum Einsatz zu bringen”, betonte Pradeep Pinakatt. Der Einsatz modernster Sicherheitstechnik am größten Flughafen in NRW sollte für alle Beteiligten eine Top-Priorität sein.
Luftverkehrssteuer: Schritt in die richtige Richtung – aber nicht genug
Lars Redeligx adressierte die von der Bundesregierung angekündigte Rücknahme der letzten Erhöhung der Luftverkehrssteuer und wertete dies als wichtiges Signal. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seien jedoch weitere Schritte erforderlich. Von zwei Milliarden Euro Zusatzbelastung des deutschen Luftverkehrs im Vergleich zum europäischen Durchschnitt verbleiben mit der beschlossenen Absenkung immer noch 1,6 Milliarden Euro. “Es braucht daher weitere Entlastungen – bei Steuern und Gebühren sowie durch Bürokratieabbau – damit Flugzeuge nicht vorrangig in anderen europäischen Ländern stationiert werden, sondern in gleichem Maße auch in Deutschland”, erläuterte Redeligx.
Dabei ordnete er die Rolle des Luftverkehrs auch vor dem Hintergrund aktueller weltpolitischer Entwicklungen ein: “Wir leben in herausfordernden Zeiten. Der Übergang zu einer multipolaren Weltordnung geht mit Spannungen und der Verschiebung von Machtgefügen einher.” Wenn man an das Nachkriegseuropa denke, entstehe Frieden nicht nur durch Verträge und Handelsabkommen, sondern auch durch Mobilität, Kontakte und Austausch. “Deswegen ist Luftverkehr mehr als ein Wirtschaftsfaktor. Er steht für die Verbindung und den Austausch zwischen Menschen und Kulturen und hält Gesprächskanäle offen. Und das heißt für uns: Jetzt erst recht!”
Smartes Wachstum innerhalb genehmigter Kapazität
Für einen erfolgreichen Flughafen braucht es auch eine passende Betriebsgenehmigung. Um die Funktionalität und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern, die rund 20.000 Arbeitsplätze zu erhalten und die Konnektivität der Region zu stärken, hat der Airport im Dezember einen Anpassungsantrag für das laufende Planfeststellungsverfahren eingereicht.
Beide Geschäftsführer betonten, dass der Flughafen keine neue Start- und Landebahn und kein neues Terminal baue. Die vorhandene Infrastruktur solle im Rahmen der heute genehmigten Kapazität nur besser und flexibler genutzt werden. Der Airport setzt auf smartes Wachstum und bringt Betrieb und Wachstum bestmöglich mit dem Schutz der Anwohner und der Umwelt in Einklang.
Foto: Flughafen