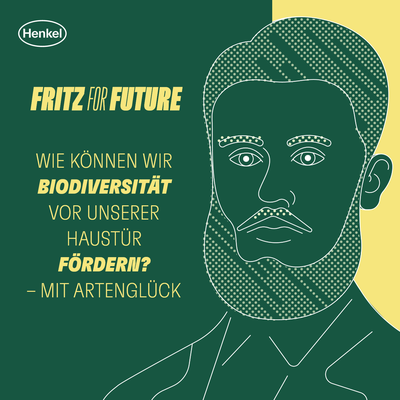Foto: Lagardère
(cs) Der Flughafen Düsseldorf startet in eine neue kulinarische Ära: Nach einer europaweiten Ausschreibung wurden die renommierten Unternehmen Lagardère Travel Retail Deutschland, Casualfood und SSP als Betreiber von insgesamt zwölf neuen gastronomischen Flächen ausgewählt. Gemeinsam mit den kürzlich vergebenen elf Flächen im Bereich Buch, Presse und Convenience wird das kulinarische Angebot am größten Airport Nordrhein-Westfalens neu definiert.
Kulinarische Vielfalt mit zeitgemäßem Konzept
„Unser Ziel ist es, in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere zu den besten Flughäfen Europas zu gehören. Eine exzellente Gastronomie mit hoher Aufenthaltsqualität ist dabei ein zentraler Faktor. Jetzt haben wir die Weichen für eine moderne und innovative Gastronomielandschaft gestellt“, betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Foto: Casualfood
Neue Marken und Konzepte am DUS
Besonderes Augenmerk wurde auf Qualität, Vielfalt, Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt. Darüber hinaus spielt ein hochwertiges Takeaway-Angebot sowie die Integration digitaler Services eine wichtige Rolle. „Mit den neuen Konzepten setzen wir Trends und sprechen gezielt neue Zielgruppen an“, erklärt Pia Klauck, Leiterin Commercial Operations am Flughafen Düsseldorf.
Zu den Neuerungen gehören aufstrebende internationale Marken, die den Flughafen Düsseldorf als ersten Travel-Standort in Deutschland wählen. Casualfood bringt beispielsweise das auf Hühnergerichte spezialisierte Franchise „Slim Chickens“ nach Flugsteig C. Lagardère eröffnet erstmals in Deutschland „Popeyes“, das mit kreolischer und Cajun-Küche in der Ankunftsebene begeistert. „bona‘me“, ein aus der Rhein-Ruhr-Region stammendes Franchise für moderne kurdisch-türkische Küche, wird von Lagardère erstmals an einem Flughafen gleich zweimal in Flugsteig C vertreten sein.
Lifestyle, Regionalität und italienisches Flair
Für ein junges, trendbewusstes Publikum kommt „EL & N London“ in die Shopping Mall der Abflughalle. Der Fokus liegt auf stilvollem Design und einzigartigen Food-&-Beverage-Kreationen mit hoher Instagramability. Ein weiteres Highlight ist das „Rheinbissen“ in Flugsteig A, das mit rheinischer Gastlichkeit und regional inspirierten Speisen wie dem „Düsseldorfer Zwiebel-Senf-Burger“ punktet.
Ein besonderer Genussmoment erwartet Reisende an der neuen Mionetto Prosecco Bar, die vor der großen Rolltreppe in der Abflughalle zum stilvollen Verweilen einlädt. Hier können Gäste prickelnden Mionetto Prosecco, raffinierte Aperitivos und feine Snacks genießen.
Business trifft Genuss: Neue Meeting- und Arbeitswelten
Auch das Konferenzzentrum des Flughafens wird neu aufgestellt: Casualfood holt sich dafür den Meeting- und Eventspezialisten memox als Partner an Bord. Gemeinsam entstehen moderne Arbeits- und Konferenzräume mit innovativer Technik und erstklassigem Catering.
Bewährtes bleibt, Neues entsteht
Kamps bleibt mit zwei Standorten am Flughafen vertreten und feiert hier die Premiere seines neuen Architekturkonzepts mit zeitgemäßen Materialien, digitalen Menübords und innovativen Designelementen. Auch das beliebte Casualfood-Konzept „Goodman & Filippo“ in Flugsteig A wird einem umfassenden Re-Design unterzogen.
Partnerschaftliche Zukunftsausrichtung
Anja Dauser, Prokuristin und Leiterin Commercial der Flughafen Düsseldorf GmbH, betont die Bedeutung der langjährigen Partnerschaften mit Casualfood und SSP und freut sich, mit Lagardère einen neuen starken Partner gewonnen zu haben. Jochen Halfmann, CEO Lagardère Travel Retail Deutschland, sieht die Kooperation als Meilenstein für die nationale Wachstumsstrategie: „Unser Ziel ist es, an jedem Touchpoint ein besonderes Erlebnis mit lokalem Flair zu schaffen.“
Zukunft der Flughafen-Gastronomie
Die ersten neuen Gastronomieflächen eröffnen im Frühjahr 2026. Bis 2027 wird sich das kulinarische Angebot am Flughafen Düsseldorf mit neuen, innovativen Konzepten weiterentwickeln – ein echter Wandel für den Genuss der Reisenden.