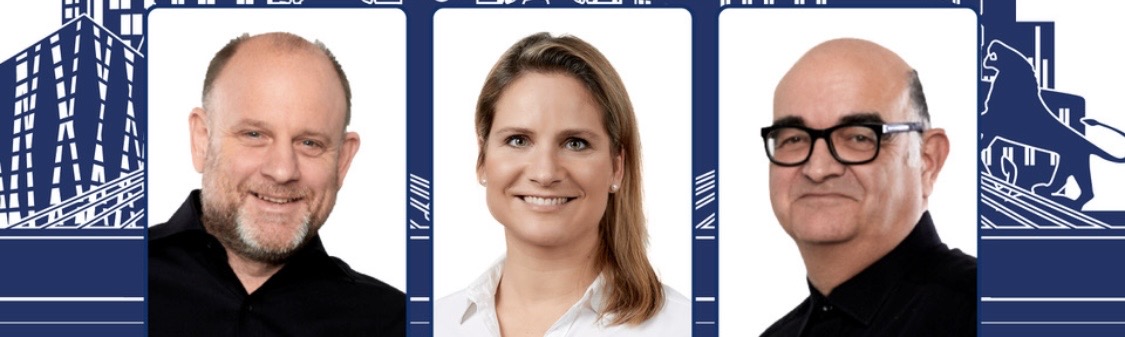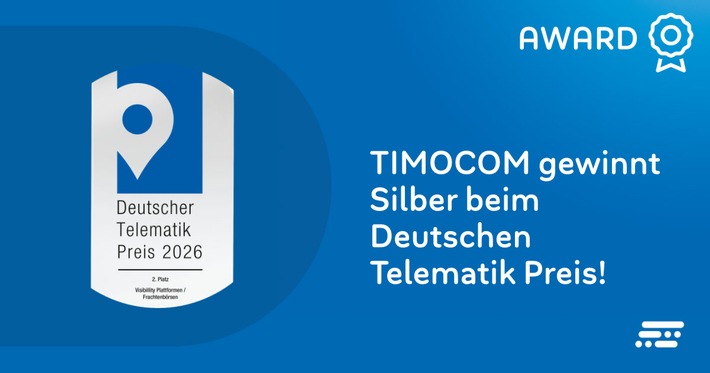(ud) Die Stimmung in den Unternehmen der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie bleibt nach dem langjährigen Tiefpunkt vor Jahresfrist auch zum Jahreswechsel 2025/26 weiterhin tief im Keller. Jedes vierte Unternehmen muss Stellen abbauen. Der Präsident von Metall NRW, Arndt Kirchhoff, nannte die Ergebnisse in der Rheinischen Post „Ausdruck einer gravierenden Standortschwäche, die durch massive geopolitische Unsicherheiten noch verstärkt wird“.
Dies ist das Ergebnis einer in Düsseldorf vorgelegten aktuellen Konjunkturumfrage des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen (METALL NRW) zum Jahreswechsel 2025/2026, an der 354 Betriebe mit fast 95.000 Beschäftigten dieses Industriezweigs teilgenommen haben. Das Ergebnis deckt sich mit derselbigen Umfrage unter den Betrieben in Düsseldorf.
Die darin abgebildeten Branchen sind unter anderem der Maschinenbau, die Elektroindustrie, der Automobilbau, Hersteller von Metallerzeugnissen, die Metallerzeugung und -bearbeitung sowie Gießereien. Nur 14 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, für die nächsten sechs Monate rechnen gerade einmal zehn Prozent mit einer Besserung. Eine Umkehr des Trends, wonach in der größten Industriebranche Nordrhein-Westfalens die Produktion inzwischen um 23 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2018 liegt und seit Juni 2024 Monat für Monat rund 2.100 Arbeitsplätze verloren gehen, ist auch für das Jahr 2026 nicht in Sicht.
Die Rheinische Post ergänzt in ihrer Ausgabe vom 02. Januar 2026: Da die Arbeitgeber die Hälfte der Sozialabgaben tragen, treffen die steigenden Krankenkassen-Beiträge 2026 auch sie. Künftig drohen zudem Renten- und Pflegebeiträge zu steigen. „Die Lage ist ernst. Ohne Reformen werden die Beitragssätze zur Sozialversicherung in nicht allzu ferner Zukunft 50 Prozent erreichen“, hatte unlängst die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, gewarnt. Sie forderte, alle zehn Jahre das Rentenalter um sechs Monate anzuheben.
Der Präsident von METALL NRW, Arndt G. Kirchhoff, bezeichnete die Ergebnisse der Umfrage seines Verbandes als „Ausdruck einer tiefen Wettbewerbsfähigkeitskrise und gravierenden Standortschwäche, die durch massive geopolitische Unsicherheiten noch verstärkt wird“. Er beobachte eine anhaltend pessimistische Stimmung in vielen Unternehmen dieses Industriezweigs quer durch alle Branchen, Betriebsgrößen und Regionen Nordrhein-Westfalens. Insbesondere mit Blick auf wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen in Brüssel und Berlin begegne ihm immer wieder eine bittere Mischung aus tiefer Unruhe, großer Verunsicherung und zuweilen sogar Fassungslosigkeit in der Unternehmerschaft. „Bei Unternehmerinnen und Unternehmern im Land verstärkt sich der Eindruck, beträchtliche Teile der Politik hätten ungeachtet der seit drei Jahren bestehenden Rezession ein immer noch massives Erkenntnisproblem, die wirtschaftlichen Realitäten auch nur wahrzunehmen“, sagte Kirchhoff.
So jedenfalls sei ein nachhaltiger und dringend notwendiger Stimmungswechsel in den Betrieben nicht herbeizuführen. Die Politik müsse endlich begreifen, dass es die international nicht mehr wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen den Unternehmen hierzulande immer schwerer machten, mit den rasanten und zum Teil dramatischen Veränderungen auf den globalen Märkten Schritt halten zu können. „Ich kann immer nur wiederholen: Wenn wir massive Wohlstandsverluste in unserem Land verhindern wollen, darf die Politik keine Zeit mehr verlieren, um grundlegende Reformen umzusetzen“, betonte der NRW-Metallarbeitgeberpräsident. Deutschland müsse endlich zur Kenntnis nehmen, dass sich wichtige Volkswirtschaften der Welt nicht mehr an die Handelsregeln hielten und ihre Märkte lieber mit Zöllen abschotteten, die Kontinente in Einflusszonen zerfielen, in denen die jeweiligen Großmächte mit radikalen Mitteln eine ausschließlich interessengeleitete Machtpolitik betrieben. In dieser für die Exportnation Deutschland so schwierigen globalen Gemengelage müsse die Politik umso mehr alles daransetzen, im Inland ihre Hausaufgaben in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu machen.
Vor diesem Hintergrund warnte Kirchhoff eindringlich vor der Illusion zu glauben, die bisherigen Maßnahmen in der Energie- und Steuerpolitik würden bereits reichen, um die Wettbewerbsposition des Standorts Deutschland grundlegend zu verbessern. Nach wie vor sei der schwere Rucksack für die Betriebe mit immer noch zu hohen Energiekosten, international nicht konkurrenzfähigen Steuerlasten und Arbeitskosten, kurzen Arbeitszeiten, einer in Teilen sanierungsbedürftigen Infrastruktur, einer erdrückenden Bürokratie und langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren prall gefüllt. Er nehme zwar wahr, dass sich die Bemühungen zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung von Verfahren mittlerweile erhöhten. Das sei erfreulich, doch zugleich bereite ihm der parteiübergreifende Unwille der Politik, insbesondere grundlegende Reformen zur Finanzierung und Zukunftssicherung der Sozialsysteme in Angriff zu nehmen, ganz große Sorgen, so Kirchhoff.
Der NRW-Metallarbeitgeberpräsident wörtlich: „Geht der Anstieg der Lohnzusatzkosten ungebremst so weiter und liegen die Sozialbeiträge Mitte der 2030er Jahre bei 50 Prozent, brauchen wir uns in Deutschland über alle anderen Themen wie Energiepolitik, Sozialpolitik, Klimaschutz oder auch Wehrhaftigkeit bald nicht mehr zu unterhalten.“ Es gehe in den nächsten Monaten und Jahren entscheidend um eine grundlegende Verbesserung der Kosten-Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Hierbei seien auch die Arbeitskosten von großer Bedeutung. In der Metall- und Elektroindustrie würden die Tarifentgelte der Beschäftigten im April um weitere 3,1 Prozent steigen. „Für viele Betriebe in Nordrhein-Westfalen ist das schon ein ganz dickes Brett, weil der beim Tarifabschluss 2024 von Arbeitgebern und Gewerkschaften für das Jahr 2026 erwartete Aufschwung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausbleiben dürfte“, so Kirchhoff. Mit ihrer Ankündigung, auch im kommenden Jahr weiteres Personal abzubauen, sendeten viele Betriebe ein eindringliches Warnsignal.
Mit Blick auf die im internationalen Maßstab sehr kurzen Arbeitszeiten forderte Kirchhoff eine ehrliche Debatte über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. „Wir werden alle im Schnitt gesünder älter, deshalb ist es auch zumutbar, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung anzupassen“, sagte Kirchhoff. Er appellierte auch an die Gewerkschaften, in dieser Frage ihre „Politik der verschränkten Arme“ zu überdenken. Wer bei der Rente sowohl Leistungskürzungen als auch Beitragssteigerungen verhindern wolle, müsse endlich beginnen, über die dritte Stellschraube Lebensarbeitszeit pragmatisch nachzudenken.
Als „bitteren Beleg für sinkendes Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit nordrhein-westfälischer M+E-Standorte“ bezeichnete der Metallarbeitgeberpräsident die per saldo nach wie vor zurückhaltende private Investitionstätigkeit. „Wenn immer noch deutlich mehr als ein Drittel unserer Unternehmen ihre Investitionstätigkeit im Inland weiter drosseln will, dann zeigt dies die hohe Gefährdung unserer industriellen Basis“, erklärte Kirchhoff. Schon zum Jahreswechsel 2024/25 sei die inländische Investitionsbilanz klar im Minus gewesen. Die weiterhin nachlassenden oder gar fehlenden Investitionen in Innovationen oder neue Maschinen, Anlagen und Produkte würden schon in absehbarer Zeit spürbare Wohlstandsverluste erwarten lassen. Kirchhoff wörtlich: „Ich kann mich nur wiederholen: Um das Ruder wirklich herumzureißen, braucht Deutschland jetzt einen wirtschafts- und sozialpolitischen Befreiungsschlag.“
Die Ergebnisse der METALL-NRW-Umfrage im Einzelnen:
Geschäftslage: Mit der Wirtschaftslage ist die nordrhein-westfälische M+E-Industrie sehr unzufrieden, die aktuelle Beurteilung fällt noch schlechter aus als vor Jahresfrist: Gerade mal 14 Prozent der befragten Unternehmen bezeichnen ihre gegenwärtige Geschäftslage als „gut“ (2024/25: 15 Prozent). Derweil ist fast die Hälfte der Betriebe (46 Prozent) mit der aktuellen Lage „unzufrieden“ (2024/25: 48 Prozent).
Geschäftserwartungen: Auch die Geschäftsperspektiven für die nächsten sechs Monate sehen die Betriebe per saldo deutlich pessimistisch. 26 Prozent erwarten rückläufige Geschäfte (2024/25: 40 Prozent), nur 10 Prozent erwarten eine Besserung (2024/25: 5 Prozent).
Auftragslage: Die aktuelle Auftragslage lässt ebenfalls zu wünschen übrig und bewegt sich weitgehend auf dem niedrigen Vorjahresniveau.
· Die Ordertätigkeit aus dem Inland bezeichnen 8 Prozent als „gut“ (2024/25: 8 Prozent), demgegenüber 55 Prozent als „schlecht“ (2024/25: 57 Prozent).
· Die Nachfrage aus dem Ausland bewerten 13 Prozent der Betriebe als „gut“ (2024/25: 15 Prozent), dagegen 41 Prozent als „schlecht“ (2024/25: 47 Prozent).
Auftragserwartungen: Wenig verheißungsvoll ist auch der Blick nach vorn: Die Erwartungen bei den Bestellungen sind im Vorjahresvergleich per saldo noch immer deutlich pessimistisch.
· Bei den Inlandsaufträgen rechnen nur 11 Prozent mit einer Verbesserung (2024/25: 6 Prozent). An eine Verschlechterung glauben derzeit 27 Prozent (2024/25: 40 Prozent).
· Bei den Auslandsorders erwarten immerhin 14 Prozent in den kommenden sechs Monaten eine Verbesserung (2024/25: 13 Prozent). Mit einer Verschlechterung rechnen 22 Prozent (2024/25: 31 Prozent).
Ertragslage: Auch die Ertragslage ist gleichbleibend schlecht. Die Zahl der Betriebe, die ihre Erträge als „gut“ bezeichnen, verharrt ebenso auf dem niedrigen Niveau von 2024/25 (13 Prozent) wie die Zahl der Unternehmen, die ihre Ertragslage als „schlecht“ bewerten, auf dem hohen Niveau des Vorjahres (48 Prozent).
Ertragserwartungen: Der Blick auf die Erträge der nächsten sechs Monate in der nordrhein-westfälischen M+E-Industrie macht wenig Hoffnung: Mehr als doppelt so viele Betriebe rechnen eher mit einer rückläufigen Ertragsentwicklung (28 Prozent (2024/25: 41 Prozent)) als mit einer Verbesserung (13 Prozent (2024/25: 7 Prozent)).
Investitionen: Die geringe Nachfrage, die schwache Ertragslage sowie hohe Energiepreise, Arbeitskosten und Bürokratielasten machen sich unter dem Strich erneut bei den Investitionsplänen der Unternehmen bemerkbar.
· Im Inland wollen 36 Prozent der Firmen ihre Investitionen weiter zurückfahren (2024/25: 44 Prozent), nur 22 Prozent der Betriebe wollen sie dagegen ausbauen (2024/25: 14 Prozent).
· Im Ausland beabsichtigen 25 Prozent (2024/25: 31 Prozent), ihre Investitionen weiter zu drosseln, wie schon im Vorjahr planen lediglich 18 Prozent mit zunehmenden Investitionen.
Beschäftigung: Die anhaltende Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung hinterlässt in den Unternehmen im wichtigsten Industriezweig Nordrhein-Westfalens auch bei der Beschäftigung tiefe Spuren.
· Neueinstellungen: Während in den vergangenen sechs Monaten 19 Prozent der Betriebe Neueinstellungen meldeten, planen dies für das nächste Halbjahr nur noch 15 Prozent. Vor einem Jahr lagen die Vergleichswerte noch bei 16 Prozent (2. Halbjahr 2024) und 9 Prozent (1. Halbjahr 2025).
· Beschäftigungsabbau: In den vergangenen sechs Monaten haben 30 Prozent der Unternehmen Beschäftigung abgebaut, für die nächsten sechs Monate planen 25 Prozent mit einer rückläufigen Beschäftigung. Vor Jahresfrist lagen die Vergleichswerte bei 27 Prozent (2. Halbjahr 2024) und 31 Prozent (1. Halbjahr 2025).
· Kurzarbeit: Auch der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit bleibt hoch und liegt sowohl im Rückblick auf die vergangenen sechs Monate als auch beim Ausblick auf die kommenden sechs Monate bei 28 Prozent. Vor einem Jahr meldeten 27 Prozent der Betriebe (2. Halbjahr 2024) sowie 39 Prozent (1. Halbjahr 2025) Kurzarbeit.
Ausbildung: Als stabil erweist sich erfreulicherweise die Ausbildungssituation in der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie. Nach wie vor wollen fast drei Viertel der Betriebe (72 Prozent) ihr hohes Engagement unverändert beibehalten (2024/25: 71 Prozent). Allerdings: Gegenwärtig planen nur 9 Prozent der Betriebe eine Ausweitung ihres Ausbildungsplatzangebots (2024/25: 11 Prozent). 19 Prozent wollen weniger Ausbildungsplätze anbieten (2024/25: 18 Prozent).