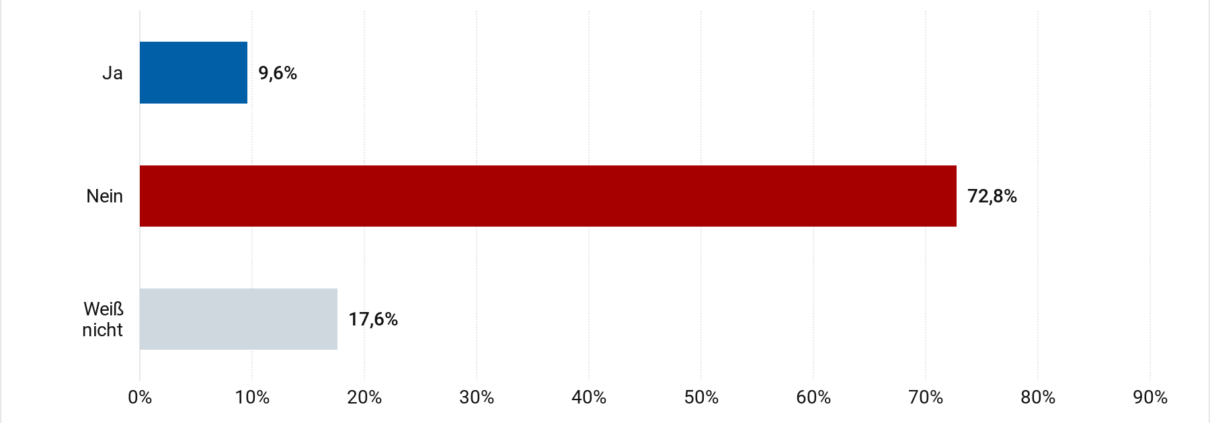(cs) Nach mehreren Jahren wirtschaftlicher Schockstarre zeichnet sich für Deutschland erstmals ein zarter konjunktureller Aufwärtstrend ab. Die neue Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) signalisiert für 2026 ein leicht positives Bild – doch ein kräftiger Aufschwung ist weiterhin nicht in Sicht. Zu groß bleiben die Unsicherheiten, insbesondere aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld. (Um das Bild komplett zu sehen, bitte anklicken.)
Lange Seitwärtsbewegung statt Erholung
Zwar konnte die deutsche Wirtschaft den pandemiebedingten Einbruch überraschend rasch überwinden, doch von dynamischem Wachstum war seither nichts zu spüren. Im dritten Quartal 2025 lag das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) lediglich 0,1 Prozent über dem Jahresdurchschnitt 2019 – ein Wert, der die Stagnation der vergangenen Jahre bestätigt.
Ein Blick auf die Nachfragekomponenten zeigt die Ursachen: Der Staat stabilisierte mit steigenden Konsumausgaben die Entwicklung, während private Haushalte kaum Impulse setzten. Besonders auffällig ist die Investitionsschwäche: Die Ausgaben für Maschinen, Anlagen, Forschung sowie Wohn- und Geschäftsgebäude lagen im Herbst 2025 real rund 8,5 Prozent unter dem Niveau von 2019.
Vorsichtiger Optimismus für 2026
Angesichts globaler und politischer Unsicherheiten fällt die Prognose für das kommende Jahr differenziert aus. Das IW rechnet mit einem realen BIP-Wachstum von 0,9 Prozent – ein zaghafter Aufschwung, aber noch weit entfernt von nachhaltiger Dynamik.
Zu den größten Belastungsfaktoren zählen weiterhin ungelöste geopolitische Konflikte, etwa in der Ukraine oder in Ostasien. Die US-amerikanische Zollpolitik sorgt für zusätzliche Risiken, ebenso wie potenzielle Rohstoffrestriktionen Chinas. Gleichzeitig bleibt unklar, ob die deutsche Politik kurzfristig Rahmenbedingungen schaffen kann, die Investitionen stärken.
Dennoch sieht das IW einzelne Lichtblicke: Das Sondervermögen des Bundes könnte, sofern effizient eingesetzt, einen nachhaltigen Investitionsimpuls auslösen.
Außenhandel: Leichte Belebung mit begrenzter Wirkung
Deutschland wird 2026 nur eingeschränkt vom globalen Handelswachstum profitieren. Hohe Energiekosten mindern die internationale Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen. Die Exporte dürften preisbereinigt lediglich um 0,3 Prozentzulegen. Während Europa leichte Impulse liefern könnte, bleiben die Perspektiven im Handel mit den USA und China verhalten. Die Importe wachsen voraussichtlich stärker als die Exporte – unter anderem aufgrund höherer Ausgaben für militärische Ausrüstung.
Investitionen: Erste Erholungstendenzen
Nach Jahren der Flaute dürfte 2026 erstmals wieder Bewegung in die Investitionstätigkeit kommen. Das IW erwartet ein reales Wachstum der Anlageinvestitionen von 2,2 Prozent.
-
Ausrüstungsinvestitionen (u.a. Maschinen, Nutzfahrzeuge) drehen ins Plus, vor allem durch Ersatzbeschaffungen – die Prognose bleibt hier allerdings besonders unsicher.
-
Bauinvestitionen könnten um 1,5 Prozent steigen, dank leicht verbesserter Bedingungen im Wohnungsbau.
-
Investitionen in sonstige Anlagen – etwa Forschung, Software oder Datenbanken – legen voraussichtlich um 3 Prozent zu. Dies deutet auf Fortschritte bei Digitalisierung und Innovation hin und gilt als positives Signal für den Standort.
Konsum: Staat bleibt Stabilisator
Der private Konsum bleibt 2026 ein Schwachpunkt. Unsicherheit und Sparneigung prägen das Verhalten der Haushalte; ein reales Plus von lediglich rund 1 Prozent ist zu erwarten. Der Staat bleibt damit weiterhin der wichtigste Nachfrageanker – ein ungewöhnliches, aber konjunkturell prägendes Muster.
Arbeitsmarkt: Kaum Bewegung
Auch am Arbeitsmarkt sind nur geringe Veränderungen zu erwarten. Der jüngste Anstieg der Arbeitslosigkeit dürfte sich nicht fortsetzen, aber neue Stellen entstehen kaum. Trotz Investitionsimpulsen bleibt der Arbeitsmarkt 2026 voraussichtlich stabil, aber ohne Dynamik. Die Zahl der Erwerbstätigen verharrt bei knapp 46 Millionen.
Fazit: Ein Schritt vorwärts – aber ein sehr kleiner
Die IW-Prognose für 2026 zeichnet ein vorsichtig hoffnungsvolles Bild: Die deutsche Wirtschaft verlässt die Null-Linie, doch der Weg bleibt steinig. Außenwirtschaftliche Risiken, politische Unsicherheiten und eine weiterhin zögerliche private Nachfrage begrenzen die Erholung. Gleichzeitig zeigen erste Investitionsimpulse und steigende Zukunftsausgaben, dass die Talsohle überwunden sein könnte.
Von einem kraftvollen Aufschwung zu sprechen, wäre jedoch verfrüht. 2026 wird ein Jahr der langsamen Stabilisierung – nicht der wirtschaftlichen Befreiung.