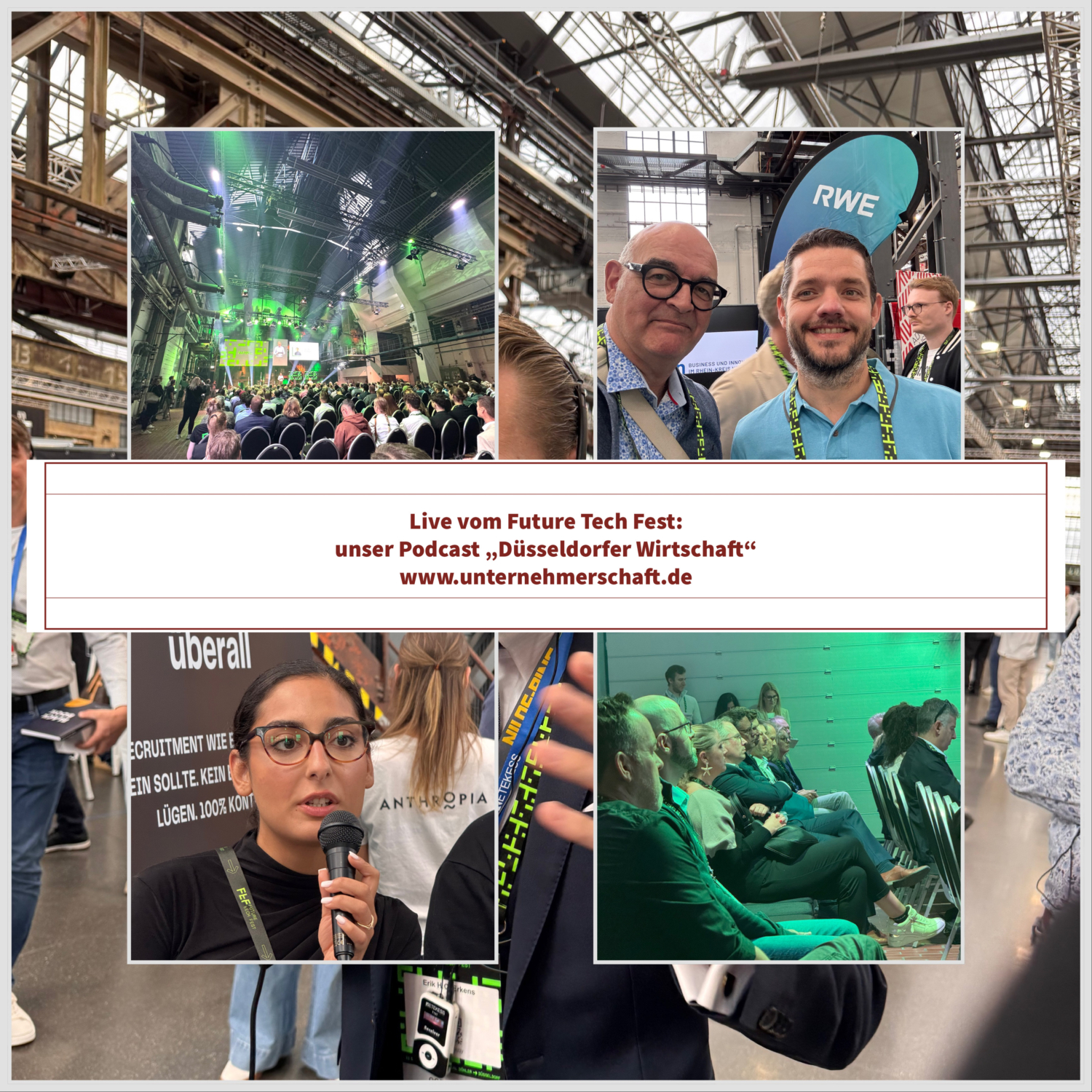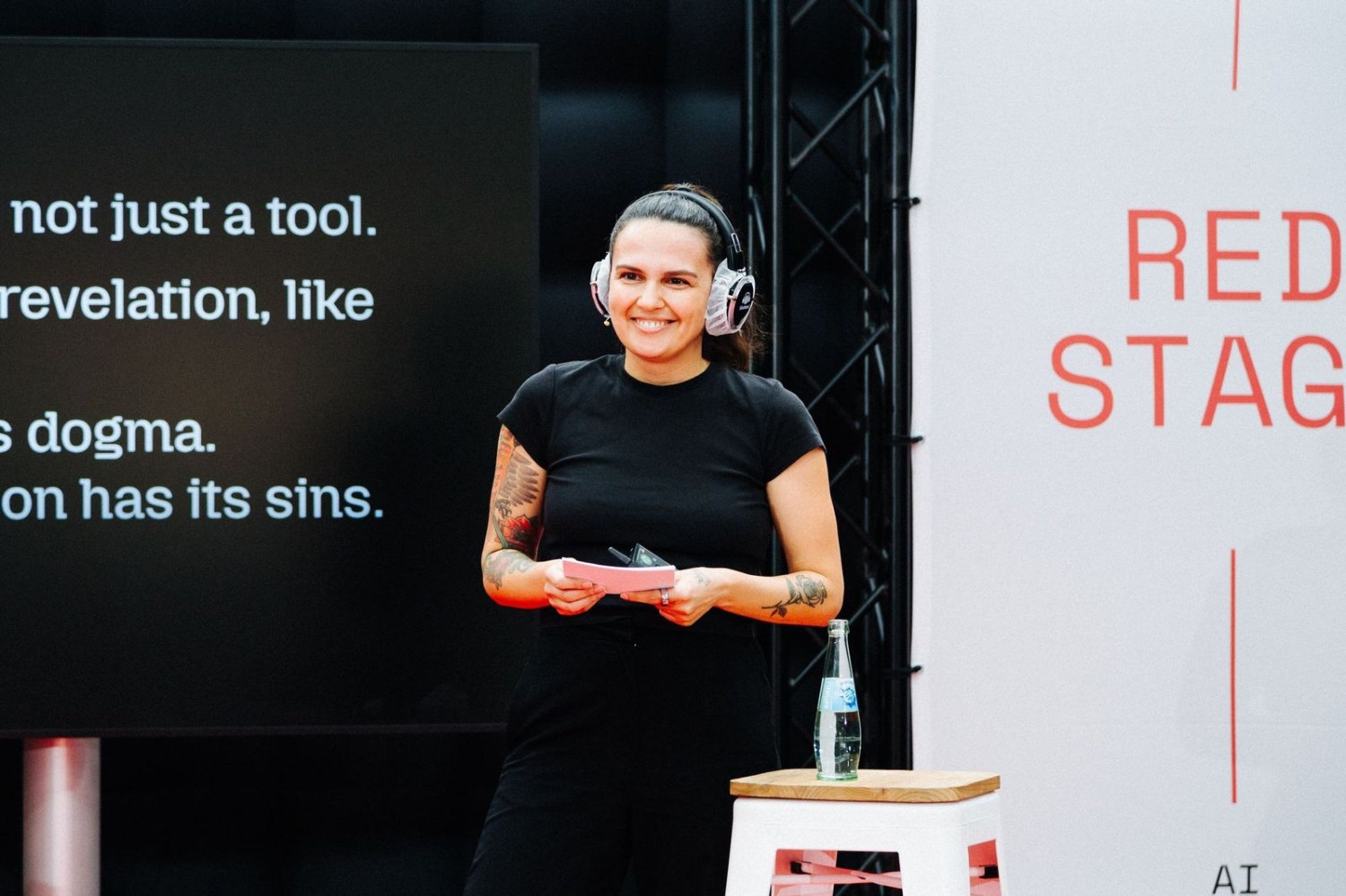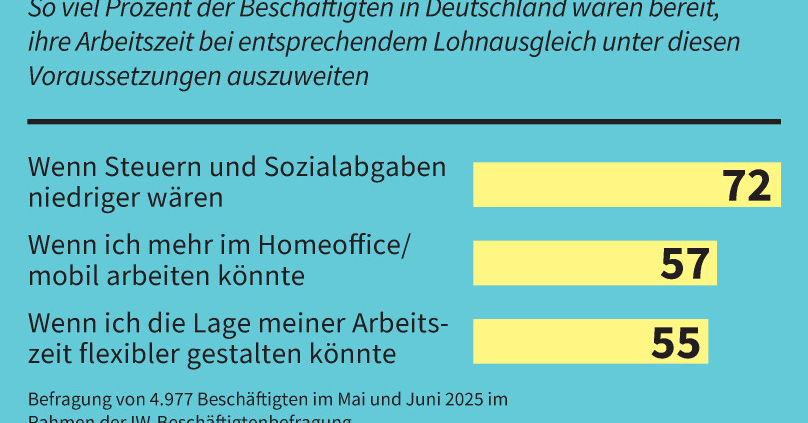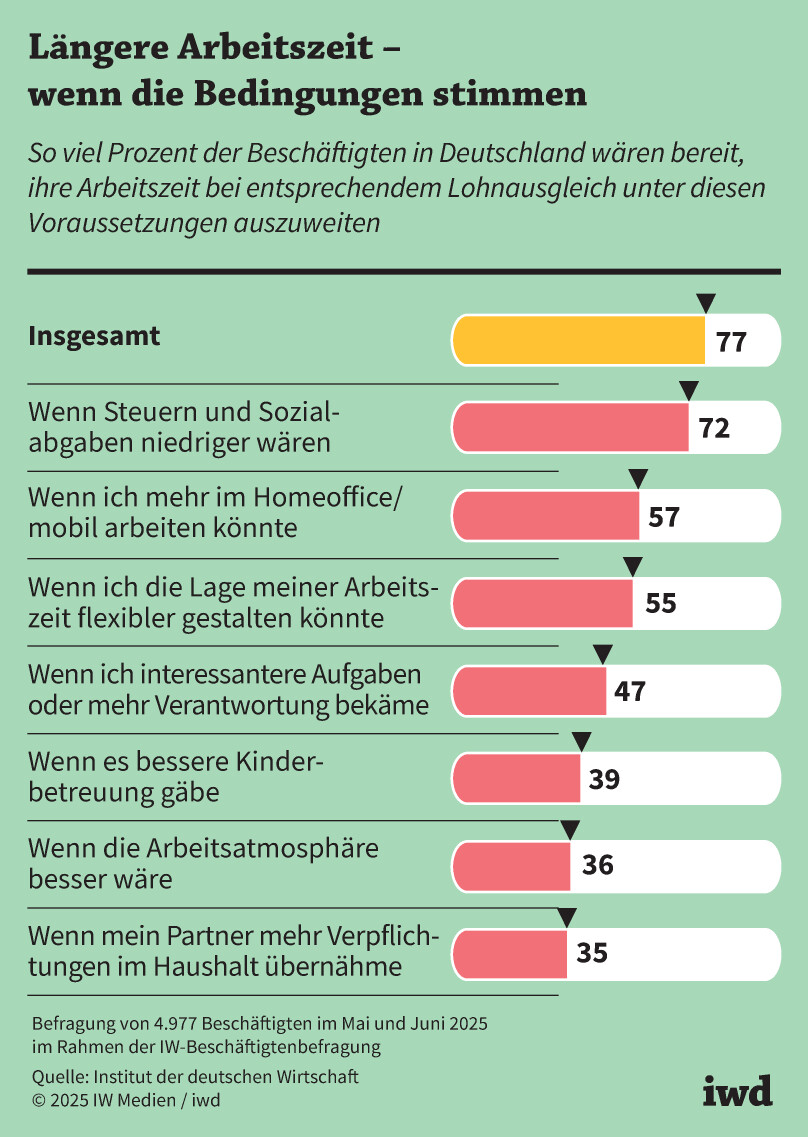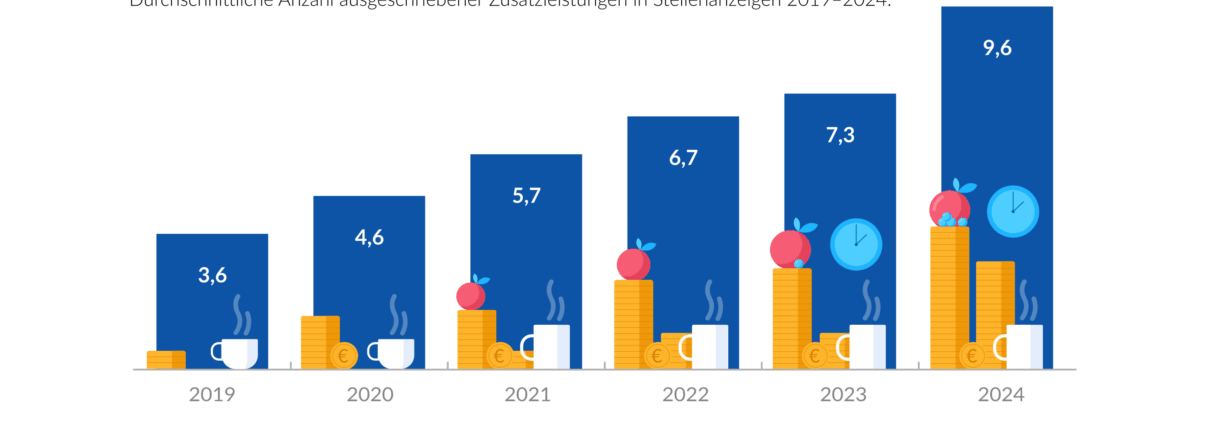(cs) Einmal neu, immer neu – das war einmal. Ich erinnere mich gut an die Zeiten, in denen ich jedes neue iPhone-Modell kaum erwarten konnte. Wenn Apple im Herbst zur Keynote rief, war klar: Mein aktuelles Smartphone wird bald ersetzt – trotz voller Funktionalität. Für mich war das ein Stück Status, ein Stück Technikliebe, vielleicht auch ein bisschen Spieltrieb. Doch diese Haltung habe ich grundlegend überdacht. Heute setze ich auf refurbished Geräte – und zwar mit voller Überzeugung.
Ich bin damit nicht der Einzige, aber leider auch nicht in der Mehrheit. Denn wie die neue Studie „Refurbished statt neu: die zweite Chance fürs Smartphone“ des Düsseldorfer Kommunikations-Unternehmen Vodafone zeigt, gehört Deutschland europaweit zu den Schlusslichtern beim Kauf von generalüberholten Geräten. Die Ergebnisse offenbaren ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Bewusstsein und Handlung.
Refurbished? Ja, bitte – meine persönlichen Erfahrungen
Vor etwa drei Jahren habe ich zum ersten Mal ein refurbished iPhone gekauft – aus Neugier, aber auch aus dem Wunsch, nachhaltiger zu konsumieren. Ich war positiv überrascht: Top-Zustand, technisch einwandfrei, deutlich günstiger als ein Neugerät – und vor allem: ressourcenschonend. Seitdem habe ich auch ein iPad generalüberholt erworben und bin bei beiden Geräten hochzufrieden.
Was mich überzeugt hat:
-
Die Geräte funktionieren tadellos.
-
Ich habe Geld gespart.
-
Ich leiste aktiv einen Beitrag zur Reduzierung von Elektroschrott.
-
Ich erhalte oft sogar Garantie – je nach Anbieter.
In meinem Freundeskreis habe ich von ähnlichen positiven Erfahrungen gehört, dennoch herrscht bei vielen in meiner Altersgruppe Skepsis.
Die Deutschen lassen ihre alten Handys in der Schublade: Mehr als die Hälfte behält ihr altes Smartphone nach dem Neukauf. Foto: VODAFONE
Studie zeigt: Deutschland zögert, besonders die Älteren
Laut der von Kantar im Auftrag des Vodafone Instituts durchgeführten und vom Wuppertal Institut wissenschaftlich begleiteten Studie kennen viele Deutsche das Konzept „refurbished“ – sie nutzen es aber selten. Im Vergleich mit vier weiteren europäischen Ländern landet Deutschland beim Kauf solcher Geräte auf dem letzten Platz. Besonders auffällig: Jüngere Menschen kaufen refurbished Smartphones fast doppelt so häufig (37%) wie ältere Generationen (18%).
Das überrascht mich nicht – schließlich bin ich selbst ein „Spätbekehrter“. Ältere Konsumenten neigen dazu, ihr Smartphone so lange zu nutzen, bis es endgültig den Geist aufgibt. Auch das ist nachhaltig – aber wenn doch mal ein Ersatz nötig ist, wäre refurbished die konsequente Wahl. Und genau hier liegt die Chance.
„Die Ergebnisse der Studie sind zugleich Weckruf, wie Hoffnungsschimmer. Weckruf, weil sie zeigen: Umdenken reicht nicht aus. Wir müssen jetzt umsetzen. Hoffnungsschimmer, weil jeder einzelne etwas zur Umsetzung beitragen kann: Die Industrie mit noch besseren Angeboten. Die Politik mit noch mehr Aufklärung. Doch vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher – mit der nächsten Kaufentscheidung“, so Michael Jungwirth, Director Public Policy & External Affairs, Vodafone Deutschland.
Einmal refurbished, immer refurbished
Besonders ermutigend: Diejenigen, die einmal auf refurbished gesetzt haben, bleiben der Idee treu. Laut Studie planen 81% der Käufer, künftig wieder ein generalüberholtes Gerät zu kaufen. Ich gehöre dazu – und kann mir inzwischen kaum vorstellen, nochmal den Neupreis für ein Smartphone zu zahlen, nur weil es „das Aktuellste“ ist.
Auch Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Präsident des Wuppertal Instituts, betont:
„Die Verwendung von refurbished Smartphones ist […] wirklich einfach umzusetzen, mit Vorteilen für den Geldbeutel und die Umwelt und schafft Wiederholungstäter.“
Recycling bleibt ein Problem – Smartphones als Schubladenhüter
Ein weiterer Punkt der Studie lässt aufhorchen: 51% der Nutzer behalten ihr altes Smartphone, wenn sie ein neues kaufen – meist verstaubt es in der Schublade. Nur 8% recyceln oder verkaufen ihr Altgerät. Das ist eine verpasste Chance: Nicht nur für die eigene Geldbörse, sondern auch für die Umwelt. Die Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber oder Kupfer – Rohstoffe, die durch Recycling wiederverwendet werden könnten.
Was braucht es, damit mehr Menschen umdenken?
Die Skepsis gegenüber refurbished Geräten ist oft unbegründet: Viele Konsumenten fürchten Leistungsprobleme oder fehlende Garantie – dabei bieten seriöse Anbieter oft genau das: geprüfte Technik, Garantiezeiten und Rückgaberecht.
Die Politik kann hier helfen, indem sie Anreize schafft – etwa durch steuerliche Vorteile, einheitliche Qualitätsstandards oder Aufklärungskampagnen. Doch letztlich liegt es an uns allen, umzudenken.
Mein Fazit: Refurbished ist gekommen, um zu bleiben
Ich bin heute nicht nur überzeugter Nutzer von refurbished Geräten – ich bin auch Multiplikator. Ich empfehle es weiter, spreche darüber, schreibe darüber. Es geht nicht um Verzicht, sondern um einen bewussteren Konsum. Um einen Wandel im Denken, den ich – zugegeben – auch erst lernen musste.
Vielleicht ist es Zeit, dass auch andere Baby Boomer den ersten Schritt wagen.
Hinweis: Die Daten stammen aus der Studie „Refurbished statt neu: die zweite Chance fürs Smartphone“, durchgeführt von Kantar im Auftrag des Vodafone Instituts und begleitet vom Wuppertal Institut.