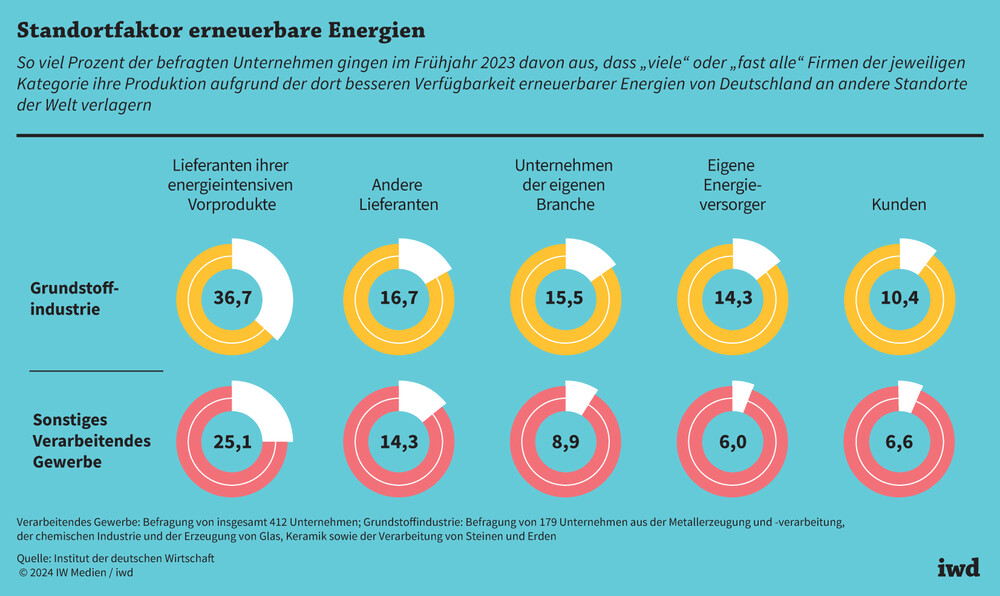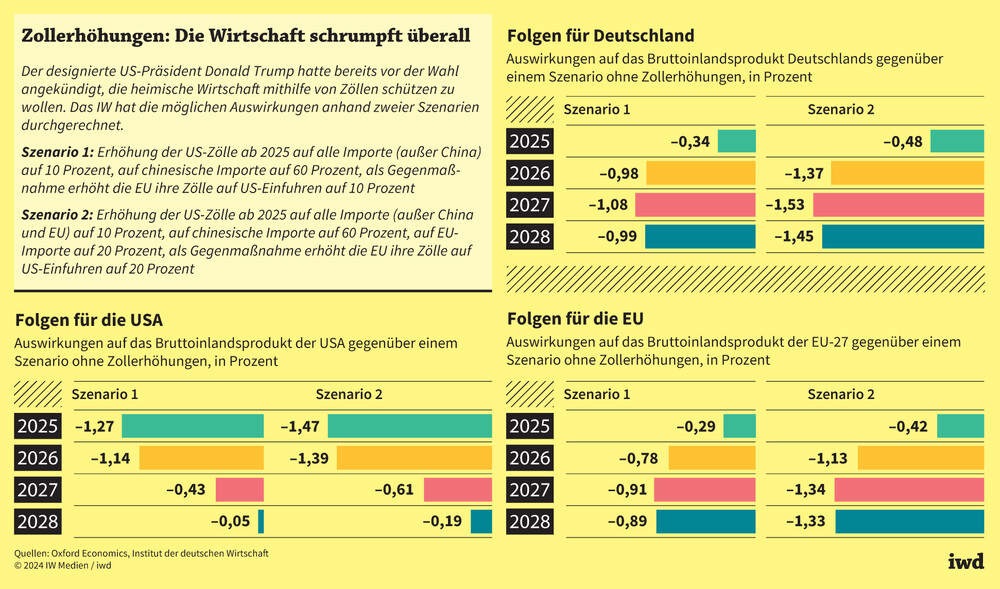Im Bild die Main-Talkshow mit unserem Hauptgeschäftsführer Michael Grütering, Professor Adam, einer Schülerin, Wissenschaftsministerin Ina Brandes, unserem Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Moderatorin Magdalena Hein (von rechts). Foto: Unternehmerschaft Düsseldorf
In den vergangenen sieben Jahren haben Tausende Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler erfahren, wie spannend und kreativ die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sein kann. Grund ist das „zdi-Netzwerk MINT Düsseldorf“, das am Montag (25.11.2024) seinen 7. Geburtstag feierte. Aus diesem Anlass präsentierte zdi-Düsseldorf bisherige Projekte und gab einen Ausblick auf zukünftige Angebote.
Seit 2018 ist das zdi-Netzwerk MINT Düsseldorf ein fester Bestandteil der nordrhein-westfälischen Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“ (zdi). Träger des Netzwerks ist die Stiftung PRO AUSBILDUNG, eine Initiative der Arbeitgeberverbände Düsseldorf.
Im Düsseldorfer zdi-Netzwerk arbeiten Unternehmen, Organisationen aus Wirtschaft und Verwaltung, Schulen, Hochschulen, Stiftungen und Vereine Hand in Hand, um Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Das Angebot reicht von spannenden Tagesworkshops bis hin zu mehrmonatigen Projekten, die sowohl in der Schulzeit als auch in Freizeit- und Ferienprogrammen stattfinden. Ob beim 3D-Druck, beim Thema „Erneuerbare Energien“ oder beim Coding – die Teilnehmenden lernen immer praxisnah und durch eigenes Experimentieren. Das Ziel: Freude an MINT-Themen wecken und gleichzeitig wichtige Schlüsselkompetenzen fördern.
Die kostenfreien Kurse können sowohl von Schulen als auch direkt von Kindern und Eltern gebucht werden. Das Netzwerk wird unterstützt von starken Partnern, darunter die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit, Hochschulen, Schulen und zahlreiche Betriebe und Branchen aus der Region.
Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, jungen Menschen zukunftssichere Perspektiven zu eröffnen und die MINT-Fachkräfte von morgen zu fördern.
Am Montag (25.11.2024) stand im Rahmen einer „Jubiläumsveranstaltung“ die Zukunft von MINT im Fokus, als Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im „Rheinblick“ zusammenkamen, um Ideen und Perspektiven für die nächsten Jahre zu entwickeln.
Ein besonderer Höhepunkt war die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung, die das Ziel unterstreicht, die Freude an MINT-Fächern zu fördern und den Zugang zu zukunftssicheren Berufen zu erleichtern. Inspirierende Impulse, wie der Auftritt von Cedric Engels, besser bekannt als Dr. Whatson, der Wissenschaft greifbar machte, und ein Gallery Walk, bei dem Trainerinnen und Trainer aus dem Netzwerk von zdi-Düsseldorf ihre Projekte präsentierten, sorgten für spannende Einblicke in die MINT-Praxis.
Den Abschluss des Tages bildete eine hochkarätig besetzte Talkrunde. Wissenschaftsministerin Ina Brandes, Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Professor Mario Adam von der Hochschule Düsseldorf, Michael Grütering von den Arbeitgeberverbänden und eine Schülerin, die ihre persönlichen MINT-Erfahrungen teilte, diskutierten über Wege, das Interesse an MINT-Fächern weiter zu fördern und nachhaltige Bildungsangebote zu schaffen.
Die Veranstaltung war nicht nur ein Rückblick auf Erreichtes, sondern auch ein Ausblick auf eine Zukunft, in der MINT weiterhin eine Schlüsselrolle für die Entwicklung von jungen Talenten in Düsseldorf spielen wird.
Weiterführende Informationen: www.mint-duesseldorf.de
Über 100 Teilnehmende kamen in den Rheinblick. Foto: Unternehmerschaft Düsseldorf
Zitate:
„Ich gratuliere dem zdi-Netzwerk MINT Düsseldorf zu seinem 7-jährigen Bestehen! Das Netzwerk hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und ist zu einem wichtigen Akteur der Beruflichen Orientierung in der Landeshauptstadt Düsseldorf geworden – davon profitieren Kinder und Jugendliche sowie Unternehmen und Hochschulen gleichermaßen. Die starke Beteiligung an der Adventure School, dem Ferienprogramm der Landeshauptstadt Düsseldorf, zeigt neben vielen weiteren Angeboten die Bedeutung und die Wirksamkeit dieser Netzwerkarbeit. Das zdi-Netzwerk in Düsseldorf führt Schülerinnen und Schüler an Zukunftstechnologien wie KI und VR heran und sensibilisiert sie für den Umgang mit diesen Werkzeugen. Damit fördert es die Zukunftsgestalterinnen und -gestalter, die wir in unserem Land dringend brauchen.“ Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen„MINT-Berufe sind ohne Zweifel Zukunftsberufe. Sie sind die Voraussetzungen für eine vielfältigere und leistungsfähigere Wirtschaft. In der Berufs- und Studienorientierung zeigen wir jungen Menschen Chancen auf, in einem MINT-Beruf die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und sie zu gestalten.“ Birgitta Kubsch-von Harten, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Düsseldorf
„Das zdi-Netzwerk MINT Düsseldorf hat in den vergangenen sieben Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Es hat Tausenden Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich mit zentralen MINT-Themen auseinanderzusetzen – viele von ihnen wären ohne diese Initiative vermutlich nie damit in Berührung gekommen. Damit leistet zdi auch einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräfte- und Nachwuchssicherung für unsere Betriebe. Unser Ziel ist es nun, noch mehr Unternehmen für die Arbeit von zdi zu begeistern. Ich bin überzeugt, dass uns das Gelingen wird.“ Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Düsseldorf
„Das zdi-Netzwerk MINT Düsseldorf ist die Eintrittskarte in die spannende Welt der Naturwissenschaft und Technik – und leistet damit einen existenziell wichtigen Beitrag, Kinder und Jugendliche für diese Welt zu begeistern!“ Dr. Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer HWK Düsseldorf
„Wir engagieren uns im zdi-Netzwerk MINT Düsseldorf, auch um dem Fachkräftemangel in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entgegenzuwirken. Jugendlichen mit MINT-Kompetenzen werden in der Berufsorientierung stärker technische und ingenieurwissenschaftliche Ausbildungen und Studiengängen bei der Berufswahl berücksichtigen. Das bedeutet in der Perspektive mehr qualifizierten Nachwuchs für die regionalen Unternehmen. Zudem unterstützen wir zdi-Düsseldorf, um die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Hochschulen und Unternehmen zu stärken und praxisnahe Bildungsangebote zu schaffen. Auch dieses Engagement fördert die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft“. Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf.
„Aus meiner Sicht sind die Schüler*innenlabore im Zentrum für innovative Energiesysteme (ZIES) der HSD ein wichtiges Element, Schüler*innen an MINT-Fächer heranzuführen. durch eine ganz praktische Erfahrung mit regenerativen Energien und ihre Möglichkeit und Perspektiven den Klimaschutz zu stärken heranzuführen. Als HSD werden wir uns auch in der Zukunft dafür einsetzen, dass es außerschulische Angebot im MINT-Bereich geben wird – nicht nur, um auf ein Studium hinzuführen, sondern auch, um Interesse an entsprechenden technischen Handwerks- und Industrieberufen zu wecken.“ Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Präsidentin Hochschule Düsseldorf
Volle Hütte im Rheinblick. Foto: Unternehmerschaft Düsseldorf