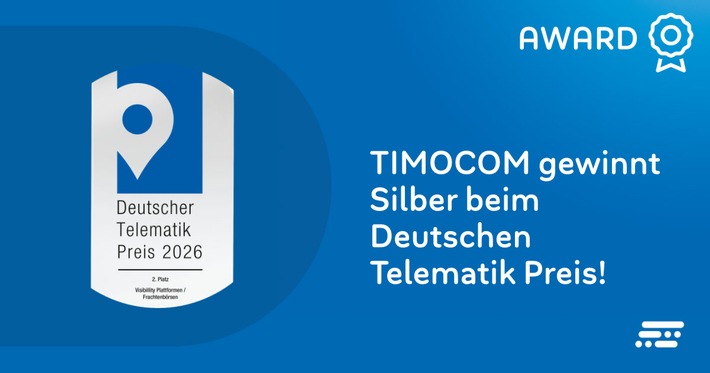Sicher durch die Silvesternacht: Provinzial in Wersten gibt Tipps
(obs) Jedes Jahr kommt es Silvester zu zahlreichen Unfällen mit Verletzungen und zu Bränden. Die Schäden gehen nicht selten in die Millionen. „Die Gründe sind fast immer leichtsinniges und unsachgemäßes Hantieren mit Feuerwerkskörpern“, so Jörg Taube, Brandschutzingenieur der Provinzial in Wersten. Er gibt Tipps, damit beim Umgang mit Böllern und Raketen nichts passiert.
„Feuerwerksartikel gehören nicht in die Hände von Kindern“, rät der Experte, „es sei denn sie sind extra für sie hergestellt und so gekennzeichnet.“ Grundsätzlich dürfen Raketen und Böller nur im Freien verwendet werden. „Ganz wichtig ist es, die Gebrauchsanleitung zu beachten und genügend Abstand zu Menschen, Häusern und Autos zu halten“, erklärt Taube, der sich neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der Provinzial auch ehrenamtlich als Fachleiter für Brandverhütung engagiert. Beim Kauf der Knaller muss darauf geachtet werden, dass diese ein Prüfsiegel der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) tragen. Nur dann sind sie zugelassen und geprüft. „Raketen sollten immer senkrecht in den Himmel geschossen werden. Ein Getränkekasten mit einer alten Flasche oder ein Eimer mit Sand sind gute Startrampen“, empfiehlt Taube. Ganz wichtig: Blindgänger nicht ein zweites Mal zünden, sondern möglichst mit Wasser unbrauchbar machen.
Wohnung, Haus und Auto sichern
Um Schäden zu verhindern, lässt sich bereits vor der Jahreswende einiges tun. Türen und Fenster der Wohnung sollten geschlossen bleiben, damit sich kein Feuerwerk hinein verirrt. Auch das Auto sollte sicher abgestellt werden, nach Möglichkeit in der Garage. „Laternenparker sollten versuchen, ihr Fahrzeug in ruhigen Seitenstraßen abzustellen und belebte Kreuzungen und bekannte Feierplätze in der Nachbarschaft meiden“, so Taube. Zwischen 23.30 und 1.00 Uhr sollte man nur zu Autofahrten starten, wenn es unvermeidbar ist.
Versicherungen helfen im Schadenfall
Verursacht das Feuerwerk einen Schaden in der Nachbarwohnung, kommt dafür die Haftpflichtversicherung des Verursachers auf. Ist dieser nicht zu ermitteln, springt die Hausratversicherung des Geschädigten ein oder die Gebäudeversicherung des Eigentümers, wenn das Haus betroffen ist.
Beim Auto ist es ähnlich: Wenn der Verursacher nicht ermittelt wird, hilft die eigene Teilkaskoversicherung, um den Brand- oder Explosionsschaden erstattet zu bekommen. Einen negativen Einfluss auf den Schadenfreiheitsrabatt hat dies nicht. Ist der Täter unbekannt, sollte der Schaden bei der Polizei angezeigt werden.